









Seit einigen Jahren schon werden auf politischer und gesellschaftlicher Ebene Maßnahmen zur Extremismusprävention von muslimischen Jugendlichen ergriffen. Wie effektiv diese Maßnahmen tatsächlich sind und auf welchen Annahmen sie beruhen, stellt Murat Gümüş kritisch in Frage.

„Mitten in der Nacht im Lichtkegel einer Laterne kriecht ein Mann auf dem Boden umher. Ein vorbei kommender Polizist fragt ihn, was er da tue. „Ich suche meinen Schlüssel“, antwortet der Mann. Daraufhin hilft ihm der Polizist und beginnt ebenfalls auf dem Boden umherkriechend nach dem Schlüssel zu suchen. Nach einer Weile fragt er ihn fast schon entmutigt: „Sind Sie denn sicher, dass Sie den Schlüssel hier verloren haben?“. „Nein“, antwortet der Mann, „verloren habe ich den Schlüssel da hinten“ und zeigt dabei mit dem Finger ins Dunkle. „Warum suchen wir dann hier?“, fragt der Polizist. Darauf antwortet der Mann: „Weil es dort hinten kein Licht gibt.“[1]
Es ist menschlich, zunächst an gewohnten Orten nach Verlorengegangenem zu suchen. Dass das nicht immer der richtige Weg sein muss, verdeutlicht das Beispiel von Watzlawick. Was tut man aber, wenn nicht nach einem Gegenstand, sondern nach (der) Ursache(n) eines Problems gesucht wird? Die menschliche Gewohnheit oder fehlendes Fachwissen führen oftmals zu einer verzerrten Wahrnehmung und Bewertung von Problemauslösern. Dessen ist man sich bewusst. Deshalb vergibt man Forschungsaufträge an Dritte, von denen man erwartet (!), dass sie genügend Objektivität und Distanz zum Untersuchungsgegenstand haben, jedoch aber auch über genügend Fachwissen und Erfahrung verfügen.
Wenn es um den Islam oder die Muslime geht, gelten andere Vorgehensweisen und Standards. Manchen erscheint gar die Suche nach der Ursache des Problems gänzlich unnötig zu sein, weil man denkt, sie bereits zu kennen. So im Fall der Sicherheitspartnerschaft in Niedersachsen unter dem damaligen Innenminister Uwe Schünemann. Durch sogenannte „verdachtsunabhängige Kontrollen von Moschee-Besuchern“ wurden in einer Zeitspanne von mehreren Jahren mehrere Zehntausend Muslime „verdachtsunabhängig“ kontrolliert. Der zu kontrollierende Personenkreises bestand aus Muslimen, die Moscheen besuchen und bis dahin nicht ein einziges Mal negativ in Erscheinung getreten sind.
Diese Information schien den regierenden niedersächsischen politischen Akteuren und Sicherheitsbehörden ziemlich egal gewesen zu sein. Sie suchten munter weiter unter dem Lichtkegel der Straßenlaterne, im hellerleuchteten Bereich, statt sich ins Dunkle zu begeben. Eine Vorgehensweise, die bei dem US-amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump auf Begeisterung stoßen könnte. Nachdem einige Religionsgemeinschaften, begleitet von couragierten Politiker*innen und Interessierten, lautstark auf die Unmöglichkeit dieser Maßnahme aufmerksam gemacht haben und u. a. auch Muslime in Niedersachsen der damaligen schwarz-gelben Regierungskoalition bei der Landtagswahl einen Denkzettel verpasst haben, wurde die Maßnahme von der folgenden Regierungskoalition eingestellt.
Die laut geäußerte Vermutung, dass in Frankreich aufgrund Extremismusverdachts 160 Moscheen geschlossen werden könnten, fußt wahrscheinlich auf einer ähnlichen Suchweise. Denn, zu diesen Moscheen gebe es lediglich den Hinweis, dass sie ohne Genehmigung betrieben würden. Nähere Untersuchungen sind bis dato nicht bekannt.
Diese Beispiele sollen nicht den Eindruck erwecken, es gebe keine Untersuchungen zu muslimischem Leben in Europa. Im Gegenteil: Muslime werden seit ca. 15 Jahren ‚umfassend‘ wissenschaftlich ‚durchleuchtet‘. Es gibt wohl kein ‚Forschungsobjekt‘, über das mehr geforscht und diskutiert wird, wie über Muslime in Europa. Die wohl ‚beeindruckendsten‘ und ‚einschlägigsten‘ Untersuchungen kommen neuerdings aus Österreich. Die Ergebnisse der jüngsten ‚Studie’ über islamische Kindergärten sollen ein so erschreckendes Bild hervorgebracht haben, dass sie als ausreichende Argumente für ihre Schließung herhalten sollen. Nimmt man das Forschungsdesign unter die Lupe, so lässt sich die Ausrichtung der Studien leicht entziffern: Die eigentliche Frage, die sich aus solchen Studien ergibt, ist die, ob die Befunde dieser Studien nicht vielleicht das Abbild des Schattens ihrer Verfasser sind, welches sie geworfen haben, als sie im Lichtkegel der Straßenlaterne nach Erkenntnissen gesucht haben.
In Deutschland hat man ein ganz anderes Problem. Hier steht man vor einem Paradoxon: Trotz zahlreicher Studien scheint man immer noch nur wenig über die Muslime zu wissen. Dies gilt insbesondere für junge Muslime. Shell-Studien, die Studien der Bertelsmann-Stiftung, Studien, die von der Deutschen Islam Konferenz (DIK) in Auftrag gegeben wurden, die Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung sind nur einige wenige Beispiele, die sich mit jungen Muslimen befasst haben.
Eines haben diese Studien gemeinsam: Sie können nicht viel für eine Erklärung des Phänomens der nach Syrien ausreisenden Jugendlichen beisteuern. Man kann sich dieses Phänomen nicht erklären. Etwaige Erklärungsansätze wie Entkulturalisierung (Olivier Roy) oder Ausgrenzungserfahrungen als Nährboden für ein Abdriften aus der Gesellschaft in radikale ‚Szenen‘ scheinen keine umfassende Begründung des Phänomens herzugeben. Sie beleuchten nur Teilaspekte, in dem Sinne, dass die meisten muslimischen Jugendlichen mit Migrationshintergrund ähnliche Stadien durchlaufen oder mit ähnlichen Probleme konfrontiert sind/werden. Eine qualitative Forschung scheint gänzlich zu fehlen.
Indes geben die Daten der Sicherheitsbehörden ein eher diffuses Bild. Es lässt sich kein ganzheitliches Profil für eine Radikalismusaffinität ableiten. Es wird lediglich konstatiert, dass die meisten Syrien-Ausreiser jung sind, aus einem eher religionsfernen Milieu kommen, vor ihrer Radikalisierung häufig strafrechtlich in Erscheinung getreten sind und sich in der ‚salafistischen Szene‘ binnen kürzester Zeit radikalisiert haben. Was genau macht sie jedoch hierfür so affin?
Zu dem Warum der Radikalisierung liegen noch keine qualitativen Forschungen vor. Trotzdem sind in den vergangenen Jahren in allen Bundesländern zahlreiche Präventionsprojekte auf den Weg gebracht worden. Beinahe alle geben an, den Jugendlichen gesellschaftliche Werte und Wissen vermitteln zu wollen und zu können, um sie so vor dem Abdriften in die Radikalität zu bewahren.
Der wohl bekannteste Träger für Prävention und Deradikalisierung ist das ‚Violence Prevention Network’ (VPN). Das VPN ist momentan Träger zahlreicher Präventions- und Deradikalisierungsmaßnahmen. Bis vor einigen Jahren noch hauptsächlich in der Tertiärprävention im Themenbereich Rechtsextremismus tätig, wurde als weiteres Themenfeld der „religiös bedingte Extremismus“ aufgenommen. Aktuell leitet das VPN u. a. die „Beratungsstelle Hessen“ in Zusammenarbeit mit dem hessischen Innenministerium. Die Beratungsstelle Hessen ist Bestandteil des hessischen Präventionsnetzwerks gegen Salafismus.
Laut Homepage hat das VPN folgende Ziele: „Die Beratungsstelle fördert die Stärkung der Toleranz von unterschiedlichen Weltsichten sowie die Früherkennung, Vermeidung und Umkehr von Radikalisierungsprozessen. Die Intervention bei beginnenden Radikalisierungsprozessen und die zielgerichtete Deradikalisierungsarbeit setzen dort an, wo Menschen einen Ausweg aus extremistischen Ideologien suchen. Einer der Arbeitsschwerpunkte des hessischen Ansatzes liegt im Bereich der frühzeitigen Information und Wissenserweiterung für Jugendliche über interreligiöse und interkulturelle Zusammenhänge sowie den Umgang mit interreligiösen Konflikten.“[2]
Das VPN bietet Informationsmaterialien bzw. Flyer, die auf der Seite des Trägers zum Download zur Verfügung stehen.[3] Diese kommen auf den ersten Blick recht harmlos daher. Wenn jedoch in einem Flyer für Extremismusprävention geworben wird, indem gerade die drei Begriffe „Islam“, „Identität“ und „Konflikt“ hervorgehoben werden, ist der Schritt zur kausalen Verknüpfung beim Außenstehenden nicht mehr weit. Kurz: Islam schafft Identität schafft Konflikt. Dies könnte eine Ausgangslage für Radikalisierungstendenzen darstellen.
Das ist nicht die einzige ‚verdachtsunabhängige‘ Maßnahme. Ein weiteres problematisches Motiv ließ sich bis vor kurzem auf der gleichen Website zum Projekt „Gesellschaftliche Reintegration“ finden.
Hier werden muslimische Jugendliche im selben Kontext mit vermeintliche Neonazis abgebildet. Darüber hinaus befinden sich diese Jugendlichen zwischen einem Palituch und dem Abbild einer wichtigen Gebetsstätte der Muslime in Palästina. Dieses Bild ruft unkommentiert eine Assoziation mit dem Nahost-Konflikt hervor. Kurz: Allein über den Nahost-Konflikt zu sprechen könnte schon als Anzeichen für eine Radikalisierungstendenz interpretiert werden. Dem Betrachter bleibt in diesem Zusammenhang nur wenig Spielraum für eine differenzierte Reflexion über die Bedeutung dieser grafischen Darstellungen.
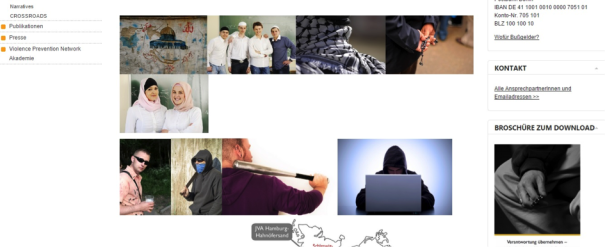
Derartige Publikationen haben das Potenzial, den Generalverdacht über junge Muslime weiter zu verbreiten und ihn zu manifestieren. Dies führt, im besten Fall, zu Verdächtigungen, wenn nicht zu Ausgrenzungserfahrungen, die sie unter Umständen aus der Mitte der Gesellschaft verdrängen und den Weg zu einer Selbstabschottung öffnen könnten. Somit wäre zumindest eine Grundvoraussetzung für ein Abdriften in die Radikalisierung erfüllt.
So schließt sich dann auch der Kreis, es entsteht ein Perpetuum Mobile der Präventionsarbeit: ein Jugendlicher, der wegen des unsensiblen Umgangs mit Begriffen in den Publikationen einer Präventionsstelle eine Ausgrenzungserfahrung erleidet, sich in Folge dessen in der Gesellschaft nicht aufgenommen fühlt, sich anschließend abschottet und eine Radikalsierungstendenz entwickelt, soll dann von einer Deradikalisierungsstelle wieder aufgefangen werden.
Nicht zuletzt die erschreckenden Terrorangriffe im November dieses Jahres haben erneut die Frage aufkommen und die Diskussion darüber neu entfachen lassen, welche Einflüsse und Faktoren die Radikalisierung von Jugendlichen begünstigen. Auf Seiten der Sicherheitsbehörden herrscht ein eher diffuses Bild, wonach eine konkrete Ursache nicht auszumachen sei. Die aktuelle Erkenntnislage scheint für eine Gesamtbewertung des Phänomens nicht ausreichend zu sein. Trotzdem entstehen überall Präventionsmaßnahmen, die in einem ausgeprägten Sendungsbewusstsein eine weite Bandbreite an Themenfeldern wie interreligiöser Dialog, politische Bildung, Wissen über Extremismus etc. abdecken.
Nicht selten erwartet man in diesem Zusammenhang auch von Moscheegemeinden, dass sie Präventionsmaßnahmen umsetzen. Und das, obwohl mittlerweile selbst Sicherheitsbehörden den etablierten Religionsgemeinschaften und ihren Einrichtungen bescheinigen, dass sie mit ihrer religiösen Unterweisung und der zahlreichen Angebote für Jugendliche vor Radikalisierungen immunisieren und dass sich hauptsächlich nur solche Jugendliche in eine gefährliche Spirale begeben, die keine Anbindung an Moscheegemeinden haben.
Anstatt die identitätsstiftende, sozialisationsunterstützende und in manchen Fällen auch resozialisierende Rolle der Moscheegemeinden würdigend zu unterstützen, erwartet man von ihnen, der Radikalisierung vorbeugende Maßnahmen umzusetzen. Diese Erwartungshaltung übersieht jedoch zwei wesentliche Aspekte. Zum einen die Tatsache, dass radikalisierte Jugendliche sich nicht in den Moscheegemeinden der etablierten muslimischen Religionsgemeinschaften radikalisiert haben. Diese Erwartung würde demnach dem Beispiel des verzweifelten Vorhabens des Mannes gleichen, der seinen Schlüssel im Lichtkegel einer Straßenlaterne sucht, obwohl er ihn an einer dunklen unbeleuchteten Stelle verloren hat. Vor diesem Hintergrund soll die hypothetische Frage erlaubt sein, wie es denn aussehen würde, wenn es die Bildungseinrichtungen und Moscheen der muslimischen Religionsgemeinschaften nicht gäbe. Zum anderen sehen sich muslimische Jugendliche in einem Spannungsfeld, was bis jetzt leider noch nicht angesprochen wurde: Nicht zuletzt nach den Terrorangriffen in Paris werden muslimische Schülerinnen und Schüler in den Schulklassen und auf dem Pausenhof immer häufiger als „Islamisten“ oder „Terroristen“ beschimpft oder mit Vorwürfen konfrontiert wie „Wo immer ihr auftaucht, explodieren Bomben“.
Wenn muslimischen Schülerinnen und Schülern, die bereitwillig an den Gedenkminuten der Schulen nach den Attentaten in Paris teilgenommen haben, die Frage stellten: „Warum machen wir nicht auch Gedenkminuten, wenn in der muslimischen Welt Terrorakte verübt werden?“, aus dieser Frage heraus eine ‚ideologische Tendenz‘ nachgesagt wird (!), entsteht bei diesen ein Gefühl der Nicht-Anerkennung bzw. der Ungleichbehandlung. Wenn nun diese muslimischen Jugendlichen dann von ihrer Moscheegemeinde zu Präventionsprojekten eingeladen werden, entsteht bei ihnen das Gefühl, dass der latente oder manifeste Gedanke des Generalverdachts, dem sie in der Schule ausgesetzt sind, mittlerweile sich auch in der Moschee etabliert hat. Die Folge ist, dass sie die Moschee meiden, weil sie sich selbst von der eigenen Moscheegemeinde ausgegrenzt fühlen.
Was uns, unserer Gesellschaft fehlt, ist ein Empfangsbewusstsein für die Probleme der Jugendlichen. Was macht sie anfällig für radikale Haltungen? Sind es negative Erlebnisse in der Familie, unter den Freunden, im Beruf, in der Gesellschaft? Sind es erlebte physische oder psychische Gewalterfahrungen? Wurde diese Person aufgrund ihrer religiösen Zugehörigkeit ausgegrenzt, oder wurden sie von ihrem Freundeskreis abgewiesen, weil sie den äußerlichen Ansprüchen der Clique nicht nachkommen wollten? Inwieweit haben erlebte, empfundene oder bezeugte Ungerechtigkeitserfahrungen eine Rolle? Warum konnte diese Person in solch einer Situation nicht aufgefangen werden? Wie kann es sein, dass Sicherheitsbehörden von der Ausreiseabsicht eines Jugendlichen eher als ihre Familien erfahren? In welchem Stadium der Radikalisierung spielt die Religion eine Rolle? Steht sie am Anfang, in der Mitte oder erst am Ende?
Das sind wichtige Fragen, die in die Problemfindung mit einfließen müssen. Vor allem müsste hierzu die Bereitschaft vorhanden sein, zuzuhören. Wenn die Politik den Jugendlichen gegenüber einen Bruchteil der Bereitschaft aufbrächte, die sie den Ängsten besorgten Bürger von PEGIDA entgegenbringt, dann hätten wir wahrscheinlich eine solide Grundlage für die Maßnahmen, die diese Jugendlichen wirklich benötigen – und nicht die, von der wir annehmen, dass sie sie benötigen. Vielleicht könnte das auch dazu führen, dass wir erkennen, wie radikal unbekümmert wir in unserem Alltag sind.
Fazit: Anstatt weiter im erleuchteten Bereich nach etwas zu suchen, was man im Dunklen verloren hat, sollte der Versuch unternommen werden, Licht ins Dunkle zu bringen.
[1] Paul Watzlawick, „Anleitung zum Unglücklichsein.“, 1995, Seite 27f.
[2] http://www.violence-prevention-network.de/de/aktuelle-projekte/beratungsstelle-hessen
[3] http://www.violence-prevention-network.de/de/aktuelle-projekte/beratungsstelle-hessen