







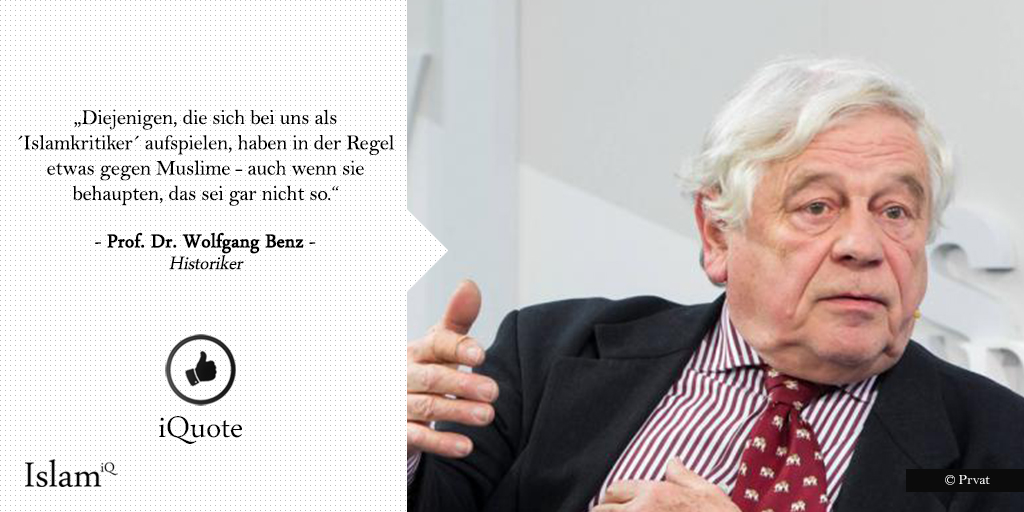

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner Grundsatzentscheidung zum Kopftuch eine Lanze für die pluralistische Gesellschaft gebrochen. Es hat aber auch deutlich gemacht, dass sein Appell gesellschaftlicher Akzeptanz bedarf und Konflikte zur Einschränkung von Freiheitsrechten führen dürfen.
Nach dem erwarteten Scheitern des Landesgesetzgebers wurde das höchste Gericht angerufen, eine weise Entscheidung zu einem extrem aufgebauschten Streitthema zu treffen. Dabei sollte es nicht nur die eigene Rolle reflektieren, sondern vor allem auch die Frage klären, wie mit der zunehmenden gesellschaftlichen Vielfalt und daraus resultierender Konfliktpotentiale umgegangen werden soll. Denn seit über einem Jahrzehnt wird um die Frage gerungen, ob in einer pluralistischen Gesellschaft die „vorbehaltlose“ Religionsfreiheit als eine fortschrittliche Errungenschaft zu bewahren ist oder eher als Gefahr einzuschränken ist.
Vor diesem Hintergrund ist die aktuelle Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts als ein Meilenstein zu bewerten. Es bleibt zunächst festzuhalten: Nur unter dem Schatten der Terroranschläge und der erfolgreichen Vermengung muslimischer Religiosität mit Radikalisierung und Gewalt konnte der konservative Druck zur Abwertung muslimischer Religiosität gegenüber der Christlichen sich entfalten. Die permanente Stimmungsmache gegen angebliche Indoktrinationsabsichten der muslimischen Lehrerinnen trotz Fehlens konkreter Beispiele schürte Angst. Laizisten, vor allem solche, die mit dem Etikett muslimischer Liberalität scheinbar aus dem Nähkästchen plauderten, bemühten die Hysterie und bekamen über klassische ideologische Grenzen hinweg Glaubwürdigkeit geschenkt. So ebnete diese Entwicklung der ersten Kopftuchentscheidung vom September 2003 den Weg – eine Entscheidung, die von Extremitäten geprägt war und auf der Suche nach Ausgewogenheit schon durch die Richter selbst zerrissen wurde.
Im Hinblick auf die eklatanten dogmatischen Schwächen dieser Entscheidung war es nur konsequent, sie auch aufgrund ihrer fatalen Folgen zu korrigieren. Der 2. Senat hatte sich damals vor einer Entscheidung gedrückt und die Angelegenheit den Ländern überlassen, von denen die Mehrheit der westlichen Bundesländer, unbeachtet der Leitsätze, unmittelbar nach der Verkündung gezielte Kopftuchverbotsgesetze einleitete. Am Ende waren es acht Bundesländer mit einem lex Kopftuch.
Damit hatte sich die vom Gericht erhoffte „föderale Vielfalt“ im Umgang mit dem Kopftuch nicht verwirklicht. Der angemahnte Gleichbehandlungsgrundsatz wurde nicht eingehalten. Nordrhein Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern unterschieden zwischen privilegierten und nicht privilegierten Religionen, die Religionsfreiheit für Lehrerinnen wurde unter ein Kulturvorbehalt gestellt. Die Verbotsgesetze trafen, wenn auch nicht von allen ausschließlich beabsichtigt, faktisch nur muslimische Frauen, gerade solche, die selbstbewusst im öffentlichen Leben stehen wollen und die Klischees von der im Islam unterdrückten Frau am ehesten widerlegen. In manchen Gesetzestexten wurde das Kopftuch sogar als Gegenwert zur Menschenwürde positioniert, die Trägerin einfach unter eine dem Kopftuch von außen zugeschriebene Symbolwirkung, die ihm nicht als solchem inhärent ist, subsumiert. Die Gefahr ging nicht mehr konkret von bestimmten Verhaltensweisen aus, sondern wurde abstrakt durch das Tragen des Kopftuchs an dem Festhalten der Lehrerin an ihrer Religion manifestiert. Ihre Grundrechtsposition wurde vollkommen zurückgedrängt. Ignoriert wurde, dass die Wahrnehmung der Religionsfreiheit nach der Verfassung weder ein Benachteiligungs- noch ein Ausschlussgrund bei der Zulassung zu öffentlichen Ämtern sein darf.
Nicht nur die Verfassungswirklichkeit wurde nivelliert, sondern auch unsere Lebenswirklichkeit. Unterdrückt wurde, dass eine pluralistische Gesellschaft nur dann lebendig und lebensfähig ist, wenn sich unterschiedliche Überzeugungen begegnen können und dabei Toleranz und Akzeptanz erfahren und wenn Menschen unterschiedliche Überzeugungen haben dürfen, sie pflegen und für die eintreten können. Denn der freiheitliche Verfassungsstaat geht das Risiko der Konfrontation verschiedener religiöser und weltanschaulicher Bekenntnisse bewusst ein, der Freiheit willen. Dabei anerkennt und lässt er abstrakte Gefahren zu. Dadurch stellt sie qualitative Ansprüche an die Gesellschaft, im Umgang miteinander dem Toleranzgebot zu folgen.
Dass dieser Anspruch des politischen Systems auf gleiche Grundrechte, Neutralität des Staates und Toleranzgebots im Bewusstsein von Teilen der Mehrheitsgesellschaft – bei der Kopftuchgesetzgebung repräsentiert vor allem durch die Unionsparteien – auf die christliche Religionen beschränkt und auf die Einwanderungsgesellschaft – und dabei vor allem Muslime – nicht übertragen ist, stellt die politische Ordnung vor große Herausforderungen. Diese Herausforderungen auch vor dem Hintergrund des religiös verbrämten Terrorismus und zunehmenden Rechtspopulismus zu erkennen, ist Aufgabe sowohl der Mehrheit als auch der Minderheit, insbesondere deren öffentlicher Akteure. Je diskursfähiger die Gesellschaft durch Abbau interkultureller Kontaktdefizite wird und Minderheiten den bisher weitestgehend verschlossenen Zugang zu Medien öffnet, umso stärker werden wir Kommunikation einüben und Konflikte harmonisieren können. Unabhängig davon, dass das Spannungsverhältnis zwischen dem liberalen Rechtsstaat und der demokratischen Souveränität selbstverständlich immer wieder zu Nachjustierungen führen wird, kann eine zu sich selbst anspruchsvolle Gesellschaft und deren politische Vertretung dabei den Gerichten viel abnehmen.
Die Entwicklung nach der ersten Kopftuchentscheidung hat gezeigt, dass die Politik dieser Verantwortung trotz Wegweisung nicht gewachsen war. Vor diesem Hintergrund war eine korrigierende Positionierung des Bundesverfassungsgerichts überfällig und erwartet. Dieses hat die Herausforderung angenommen und sowohl die frühere Entscheidung korrigiert, als auch die damaligen Leitsätze in Bezug auf die Gleichbehandlung von Religionen unterstrichen und dem wiedersprechende gesetzliche Regelungen als mit dem Grundgesetz unvereinbar erklärt, mit Signalwirkung für die Länder, die ähnlich wie NRW, die Ungleichbehandlung von Religionen gesetzlich verabschiedeten.
Zudem hat das Gericht ein auf abstrakte Gefahren beruhendes und denen vorbeugendes Kopftuchverbot als unverhältnismäßig abgelehnt und eine hinreichend konkrete, insoweit belegte und begründete Gefährdung oder Störung des Schulfriedens oder der staatlichen Neutralität verlangt. Dabei verlangt es eine beachtliche Zahl von substantiellen Konfliktlagen und erwartet vom Gesetzgeber Regelungen zu differenzierten, örtlich und zeitlich begrenzten Lösungen und im Konfliktfall zunächst eine anderweitige pädagogische Verwendungsmöglichkeit. Während die Abwägung mit der negativen Religionsfreiheit von Schülern sowie Eltern abschließend zu Gunsten der kopftuchtragenden Lehrerin erörtert wird, fehlen Konkretisierungen zu der Frage, wann die Schwelle zu einer hinreichend konkreten Gefährdung oder Störung des Schulfriedens oder der staatlichen Neutralität erreicht ist. Dies bietet viel Raum für Auslegungen und lässt befürchten, dass der Mangel klarer Kriterien nicht zur Rechtssicherheit bei den Betroffenen führen wird. Insbesondere das Kriterium der Quantität bei „substantiellen Konfliktlagen in beachtlicher Zahl von Fällen“ könnte die Schulen zu stark beanspruchen, sie zu Druck auf Lehrerinnen für größere Flexibilität einladen, aber auch zu Provokationen durch Eltern ermuntern. Wahrscheinlich vor diesem möglichen Hintergrund spricht das Bundesverfassungsgericht der Lehrerin trotz Betonung ihrer Grundrechtsposition keinen unbedingten Anspruch auf das Tragen des Kopftuchs zu, da es nicht ausschließen kann, dass sich mit Blick auf die Lehrerin Probleme mit Schülern, Eltern und Kollegen ergeben können und der Schulfriede dadurch nachhaltig gestört wird.
Zuversicht gibt, dass die Angstdebatten um das Kopftuch sich längst als Scheindebatten entlarvt haben, zumal die wenigen Probleme, die in Rheinland-Pfalz, Hamburg oder Schleswig-Holstein – also den Ländern, die neben den Ost-Bundesländern keine Kopftuchverbotsgesetze erlassen haben – den Behörden gemeldet wurden, nicht Indoktrinationsversuche der Lehrerin gemeldet haben, sondern Beschwerden von einigen wenigen Eltern und Lehrerkollegen, die sich provoziert fühlten.
Das Bundesverfassungsgericht hat demnach eine weise Entscheidung getroffen, stellt aber Ansprüche an die Gesellschaft und mahnt zu Akzeptanz und Toleranz. Vor allem zeigt es einen Weg auf, um leicht zuversichtlich zu sein, trotz zunehmender Islamfeindlichkeit. Im Vertrauen auf das Bewusstsein in der Gesellschaft, dass sich die Freiheitlichkeit einer Gesellschaft vor allem im Umgang mit Minderheiten zeigt und dass die Einschränkung von Freiheitsrechten von Muslime nicht nur auf sie beschränkt bleibt.