







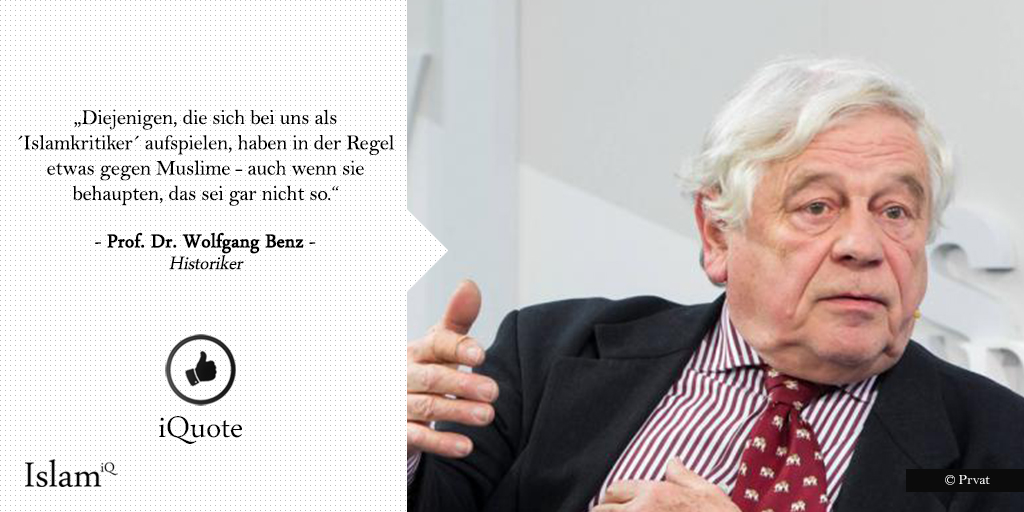

Im Alter wollen viele Menschen in vertrauter Umgebung leben. Doch was machen ehemalige Gastarbeiter, wenn die Heimat unerreichbar ist? In Hamburg gibt es zwei Modellprojekte in der Altenpflege für Migranten aus dem Orient.

Eine Seniorin will in Hamburg in einen Nahverkehrsbus einsteigen und fragt den Fahrer, ob sie mit ihm in ihre weit entfernte Heimatstadt fahren könne. Der erkennt, dass die Frau verwirrt ist und gibt sie in die Obhut einer Altenpflegerin. In der Betreuung von Demenzkranken sind solche Vorfälle alltäglich, dieser ist dennoch besonders: Die Frau ist Türkin, der Busfahrer spricht Türkisch, und die Altenpflegerin tut es auch. Die alte Frau lebt in einer betreuten Wohngemeinschaft für Demenzkranke mit türkischem Migrationshintergrund in Hamburg-Wilhelmsburg.
„Sie glaubt, in der Türkei zu sein“, sagt Altenpflegerin Sevin Candan. Die 27-Jährige kennt das auch von anderen Bewohnern der Wohngemeinschaft im Haus Veringeck. „Wenn ich sie frage: „Wo hast du geschlafen?“, sagen sie: „In meinem Dorf.““ Candan arbeitet für den Pflegedienst Multi-Kulti. Dieser versorgt hilfsbedürftige und alte Menschen aus verschiedenen Ländern. Und er versucht, ihnen ein Gefühl von Heimat zu geben.
Das als Modellprojekt zur Internationalen Bauausstellung von 2013 errichtete Haus Veringeck ist barrierefrei und altengerecht wie viele andere Einrichtungen dieser Art. Im Stil lehnt es sich allerdings an die türkische Architektur an. Die Balkon- und Treppengitter sind orientalisch gemustert, es gibt einen Therapiegarten im Innenhof, neben dem Eingangsbereich ist ein Hamam, ein türkisches Dampfbad.
Die zehn Bewohner der Alten-WG – acht Frauen und zwei Männer – haben alle ein eigenes Zimmer. Tagsüber sind sie gern im großen, hellen Gemeinschaftsraum mit Küche, Esstisch und Fernsehecke. Es wird gemeinsam gekocht und gegessen, wie in einer Wohngemeinschaft. Der Begriff lasse sich in der Form nicht ins Türkische übersetzen, sagt Yağbaşan. Er muss den Angehörigen der Bewohner viel erklären. Wenn sie sich nicht selbst ein Bild von der alternativen Wohnform gemacht haben, halten sie die Einrichtung meist für ein Pflegeheim. Und seine betagten Eltern dahin zu geben, ist für Türken eigentlich tabu.
Die Demenz-WG ist nur ein kleiner Teil der Arbeit von Multi-Kulti. Der Pflegedienst betreibt im selben Gebäude eine internationale Tagespflege und versorgt die Bewohner von Seniorenwohnungen im ersten und zweiten Stock sowie viele weitere Pflegebedürftige im Stadtteil. Yağbaşan legt Wert darauf, dass das von seiner Mutter gegründete Unternehmen weder an eine Nationalität noch Religion gebunden ist. „Wir sprechen elf Sprachen, wir sind ein multikulturelles Unternehmen.“ Jeder könne seinen Glauben praktizieren, aber einen Gebetsraum gibt es im Haus Veringeck nicht.
In Hamburg-Wandsbek gibt es eine weitere Pflegeeinrichtung für Migranten. Vor zwei Jahren hat der Betreiber Pflegen und Wohnen in einem Nebengebäude des Heims am Husarendenkmal einen „Orient-Bereich“ für Menschen aus dem afghanisch-persischen Raum eröffnet. Die vollstationäre Abteilung mit 26 Betten sei deutschlandweit einmalig, sagt der Direktor des Pflegeheims, Witold Lesner. Ein ähnliches Projekt eines anderen Betreibers für türkischstämmige Senioren in Berlin war 2012 gescheitert.
In der Hamburger Einrichtung lebten anfangs nur vier Senioren, inzwischen sind es 19, zehn Frauen und neun Männer. Sie stammen aus Afghanistan, Iran, Pakistan, Syrien, Ghana und Deutschland. Mit etwa 35 000 Menschen hat Hamburg die größte afghanische Gemeinschaft in Deutschland. Auch für Afghanen ist es eigentlich ein Tabu, die pflegebedürftigen Eltern in ein Heim zu geben. „Viele empfinden das als familiäres Versagen oder Schande“, sagt Lesner.
Aber anders als türkische Senioren könnten Afghanen auch im Alter nicht in ihre krisengeplagte Heimat zurückkehren, erklärt Ali-Ahmad Ruhani. Der stellvertretende Pflegeteamleiter im Orient-Bereich ist selbst vor 35 Jahren aus Afghanistan geflüchtet. 1982 erlebte er, wie seine kranke Tante in Deutschland gepflegt wurde. „Ich fand das faszinierend.“ Er entschloss sich, Altenpfleger zu werden.
Von der Bauart unterscheidet sich das Backsteingebäude des Orient-Bereichs nicht von anderen Pflegeheimen. Die Beschriftungen sind jedoch auch auf Arabisch, hinter dem großen Esstisch im Gemeinschaftsraum hängt ein großes farbenfrohes Bild mit musizierenden und tanzenden Sufis aus Marokko. Zwei Zimmer sind zu prächtigen Gebetsräumen mit Teppichen, Sofas mit gold-rot glänzenden Bezügen und üppigen Gardinen umgestaltet, einer für Frauen und einer für Männer. Die Bewohner nutzten die Räume aber kaum, nur die Angehörigen und auch mal die Pfleger, sagt Ruhani.
Die Bewohner wollten vor allem eins: Gut gepflegt werden. Doch das sei manchmal auch eine Herausforderung für die Betreuer. Es sei vorgekommen, dass einer Bewohnerin eine Pistazie heruntergefallen sei und sie daraufhin nach dem Personal geklingelt habe, um die Trockenfrucht wieder aufheben zu lassen. Deutschen Pflegekräften falle es schwer, sich an ein solches Verhalten zu gewöhnen. „Frauen sind die Chefs zu Hause, überall im Orient“, erklärt Ruhani. „Die wollen manchmal mehr bedient als gepflegt werden.“ Aber nicht alle Bewohner teilen diese Einstellung. „Wer bei jeder Kleinigkeit nörgelt, der leidet selbst darunter“, sagt der ehemalige Arabisch- und Deutschlehrer Mohamad Walid Salaho (62) aus Syrien.
Ruhani betont zugleich die große Dankbarkeit der Alten. „Das ist die eigentliche Belohnung“, pflichtet Lesner bei. Und auch Candan im Haus Veringeck freut sich, wenn sie für ein Glas Wasser schon ein Dankgebet bekommt. „Diese Dankbarkeit motiviert.“ (dpa, iQ)