









Muslimische Islamkritiker sind in der Politik gern gesehene Gäste. Muslime sind eher skeptisch. Ali Mete zeigt am Beispiel des Islamwissenschaftlers Abdel-Hakim Ourghi, warum diese Skepsis ihre Berechtigung hat.
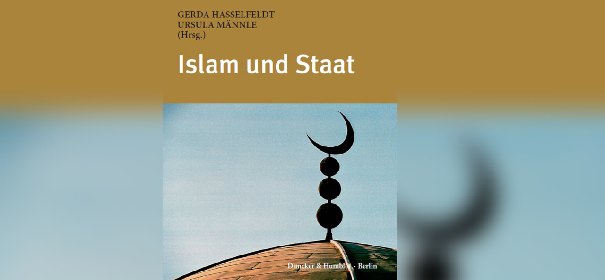
Fälle wie der Skandal um die sogenannte Kindergartenstudie des Wiener Professors Ednan Aslan haben einen positiven Nebeneffekt: Sie machen einen skeptischer gegenüber der Arbeit sogenannter muslimischer Islamkritiker. So wurde die Wissenschaftlichkeit bzw. akademische Unabhängigkeit Aslans zurecht angezweifelt. Das außeruniversitäre Prüfungsverfahren läuft noch.
Mit der gleichen Skepsis sollten z. B. die Publikationen des Freiburger Wissenschaftlers Abdel-Hakim Ourghi betrachtet werden, geben sie doch einen Eindruck in das, was in diesen Kreisen unter einer fundierten und differenzierten Arbeit verstanden zu werden scheint. Hierfür sei exemplarisch ein Aufsatz des Autors angeführt, der im Sammelband „Islam und Staat“ (Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2017) erschienen ist. Die hier versammelten Beiträge gehören zu einer Vortragsreihe der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, deren Ziel es ist, dass sich „die Abgeordneten der CSU-Landesgruppe mit Expertinnen und Experten über die verschiedenen Aspekte islamischen Lebens in Deutschland (austauschen), um die Integrationsfähigkeit des Islams besser verstehen und fördern, aber auch die sicherheitsrelevanten Dimensionen, besser einschätzen zu können“ (S. 5). Ein Fachgremium also.
Natürlich steht es jedem offen, konträre und unangenehme Ansichten zu haben und zu verbreiten; das belebt die Diskussion. Jedoch wirft es auf die Seriosität einer Person kein gutes Licht, insbesondere wenn es sich um einen Wissenschaftler handelt, wenn hart erkämpfte und erprobte Grundlagen geltenden Rechts mir nichts dir nichts ausgeblendet werden und populären Forderungen nachgejagt wird. Genau das tut Abdel-Hakim Ourghi aber. Dabei scheint das Vorgehen Ourghis auch die These zu stützen, dass, wenn es den Islam und die Muslime betrifft, verfassungsrechtliche Prinzipien nicht so eng gesehen zu werden brauchen.
Im Folgenden soll anhand einiger Textpassagen verdeutlicht werden, was damit gemeint ist. Ourghi bedauert, dass „ein einheitliches Islamverständnis unter den Muslimen in Deutschland überhaupt nicht vorhanden ist, nicht einmal unter Sunniten“ (S. 13). Frage: Muss es das? Muss es ein solches einheitliches Verständnis überhaupt geben? Islamische Religionsgemeinschaften bemühen sich seit langem um eine gemeinsame Vertretung der Muslime in Deutschland – das ist möglich und auch sinnvoll. Das Grundgesetz lässt aber auch zu, ja fördert und ist eine sehr gute Grundlage dafür, verschiedene Sichtweisen nebeneinander gelten zu lassen. Ourghis Formulierung lässt aber darauf schließen, dass es besser oder notwendig sei, wenn es einen einheitlichen Islam gebe. Genauso sind diese Aussagen kaum zu vereinbaren mit der ansonsten „progressiven“ und auf Meinungsfreiheit und der Geltendmachung unterschiedlicher Islamverständnisse befürwortenden Haltung von Personen vom Schlage eines Ourghi.
Eng verknüpft mit diesem Aspekt ist die Feststellung des Autors, dass diese fehlende Einheitlichkeit „aus Sicht des deutschen Staatskirchenrechts“ (S. 14) ein Problem sei und dies ein Hindernis für den Körperschaftsstatus sein könne. Dabei verlangt das Religionsverfassungsrecht gar nicht, dass es pro Religion eine Religionsgemeinschaft gibt. Wieso erwartet das dann Ourghi von islamischen Religionsgemeinschaften? Oder zugespitzt formuliert: Wieso müssen islamische Religionsgemeinschaften zu einer einheitlichen Struktur finden, wenn die Verfassung und das Staatskirchenrecht, ausgehend von einem weit gefassten Religionsbegriff und der Vielfalt religiös-weltanschaulicher Vorstellungen, gerade die Vielfalt ermöglicht?
Die fehlende Einheit ist laut dem Autor nicht nur politisch, sondern auch theologisch zu begründen, denn auch aufgrund der vier Rechtsschulen sei „bis heute ein einheitliches Denken oder eine Organisation in kirchenähnlichen Strukturen dem Islam fremd“. Dies bedeute, dass „bestimmte Glaubensrichtungen innerhalb des Islams keine Religionsgemeinschaft im staatsrechtlichen Sinne darstellen“ (S. 16) könnten. Genau das ist aber laut deutschem Staatskirchenrecht möglich. So jedenfalls laut dem Staatskirchenrechtler Heinrich De Wall, der im selben Sammelband schreibt: „Anders als in anderen Rechtsordnungen gibt es in Deutschland keine formale Anerkennung von Religionsgemeinschaften durch staatliche Behörden. Wenn sich eine Gemeinschaft von Menschen religiös betätigen möchte, – sei es privat, sei es öffentlich – kann sie dies tun, ohne dazu einer behördlichen Anerkennung zu bedürfen.“ Weiter unten heißt es: „Das bedeutet aber nicht, dass islamische Religionsgemeinschaften genauso organisiert sein müssten wie Kirchen. Sinn der grundgesetzlichen Regelungen ist es nicht, durch das Aufstellen von formalen Erfordernissen die Geltendmachung der Rechte von Religionsgemeinschaften zu erschweren.“ (S. 47). Ein offener Widerspruch, zu dem sich der Autor auf Anfrage – aus zeitlichen Gründen – nicht äußern wollte.
Wenn laut Ourghi, islamische Religionsgemeinschaften theologisch nicht in der Lage sind, eine Einheit herzustellen, um damit die vermeintlichen Bedingungen des Staates zu erfüllen, ist es nur folgerichtig, wenn er schreibt: „Möglicherweise benötigt der Staat keinen Ansprechpartner bei der Durchführung des islamischen Religionsunterrichts“ (S. 19). Aber genau das tut er sehr wohl, denn er muss neutral sein und darf in religiösen Dingen keine religiösen Inhalte vorgeben oder festsetzen. Auch hier wieder eine fragwürdige Position, die im Gegensatz zu dem sicher nicht unbedeutenden Neutralitätsprinzip steht.
Zuletzt ein Beispiel für die unbedachte Wiederholung politischer Forderungen ohne weitergehende Kenntnisse der Sachlage. Der Autor fordert die Eindämmung ausländischer Geldgeber für islamische Religionsgemeinschaften (S. 19). Prof. De Wall schreibt jedoch, dass die Finanzierung Sache der Religionsgemeinschaften ist und ein etwaiges Verbot für alle Religionsgemeinschaften gelten müsse. Insgesamt sieht er es als „äußerst anspruchsvolles Unterfangen, verfassungsrechtlich haltbare Regeln zu formulieren, die etwa den Empfang von Spenden aus dem Ausland für islamische Religionsgemeinschaften beschränken“ (S. 50).
Insgesamt sollte es nachdenklich stimmen, dass der Autor in wichtigen Fragen der rechtlichen Organisation religiösen Lebens in Deutschland nicht auf dem Laufenden zu sein scheint. Noch bedenklicher ist, dass dies kein Hindernis zu sein scheint, als „Experte“ zur Diskussionsreihe der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag eingeladen zu werden.