







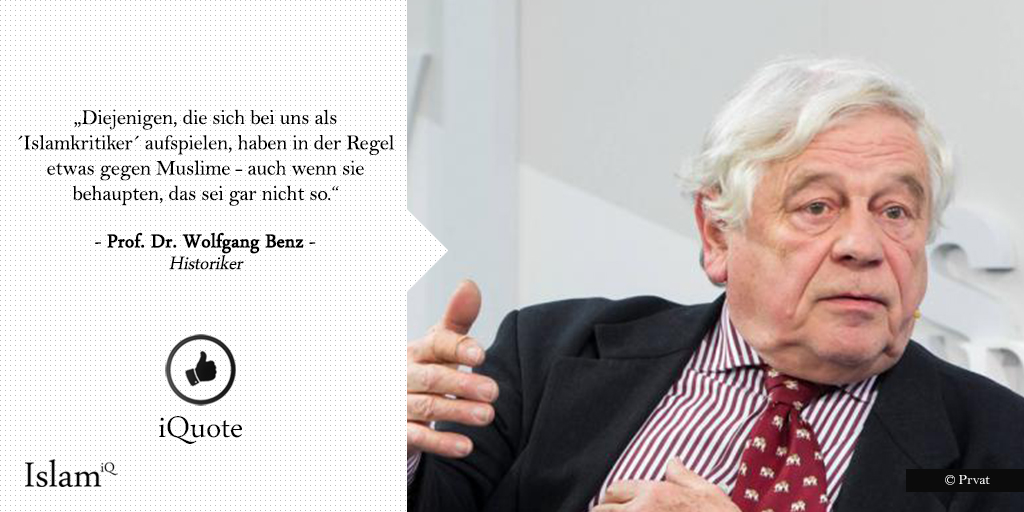

Griechenland wurde vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt, weil im Falle eines Erbstreits das islamische Erbrecht angewendet wurde. Dies dürfe nur angewendet werden, wenn die Betroffenen dadurch keine Diskriminierung erfahren.

Weil Griechenland in einer Erbstreitigkeit die Scharia statt des griechischen Zivilrechts angewandt hat, ist das Land vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt worden. Mit der Anwendung des islamischen Rechts habe der griechische Staat das Diskriminierungsverbot verletzt, urteilten die Straßburger Richter am Mittwoch (Beschwerdenummer 20452/14).
Beschwert hatte sich eine griechische Witwe, die von ihrem Mann per Testament dessen gesamten Besitz vererbt bekommen hatte – aber dann einen großen Teil einbüßte: Die Schwestern des Toten fochten das Testament an, weil der Mann einer muslimischen Minderheit angehört hatte. Griechische Gerichte gaben ihnen schließlich Recht und urteilten, dass in diesem Fall islamisches Recht gelten müsse. Die Beschwerdeführerin büßte daraufhin nach Angaben des Gerichts drei Viertel des Erbes ein. Sie machte vor Gericht geltend, dass sie alles geerbt hätte, wenn ihr Mann nicht muslimischen Glaubens gewesen wäre.
Dieser Argumentation folgten die Straßburger Richter. Griechenland habe die unterschiedliche Behandlung von Menschen verschiedenen Glaubens in Erbfragen nicht objektiv und vernünftig gerechtfertigt.
Griechenland ist das einzige EU-Land, in dem die Scharia eingeschränkt angewendet wird – in der Region West-Thrakien. Im Januar entschied jedoch das Parlament in Athen, dass muslimische Geistliche nur noch dann nach islamischem Recht entscheiden dürfen, wenn beide Streitparteien dem zustimmen. Andernfalls ist die griechische Justiz zuständig. In West-Thrakien im äußersten Nordosten des Landes lebt als Folge der jahrhundertelangen osmanischen Präsenz eine muslimische Minderheit; die Scharia gilt hier eingeschränkt seit 1923.
Staaten, die wie Griechenland spezielle rechtliche Rahmenbedingungen für einzelne Glaubensgemeinschaften eingeführt hätten, müssten sicherstellen, dass dadurch keine Diskriminierung entstehe, urteilte nun das Menschenrechtsgericht. Insbesondere müssten Angehörige der betreffenden Minderheit die Möglichkeit haben, sich für die Anwendung des gewöhnlichen Rechts zu entscheiden.
Diese Forderung dürfte mit der Gesetzesänderung erfüllt sein. Auf eine mögliche Entschädigungszahlung an die Witwe legte sich das Gericht vorerst nicht fest. (dpa/iQ)