




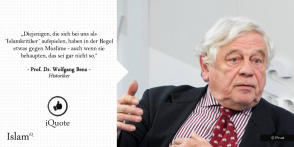
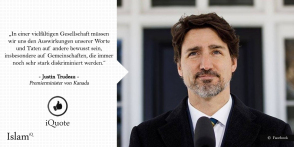

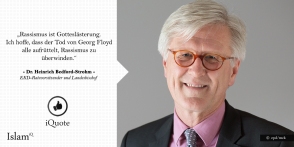

„Deutschland kann Integration“ – so zumindest die Überschrift des Berichts der Integrationsbeauftragten des Bundes. Dieser zeigt allerdings: Es gibt noch Luft nach oben – vor allem gegenüber Muslimfeindlichkeit und Antisemitismus.

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), sieht die Integration in Deutschland auf einem guten Weg. Die Bundesrepublik sei ein Einwanderungsland und „kann Integration“, erklärte die Staatsministerin anlässlich der Veröffentlichung ihres 12. Integrationsberichts am Dienstag in Berlin. Der Bericht erscheint alle zwei Jahre.
Widmann–Mauz sprach sich dafür aus, stärker gegen Diskriminierung in Bildungseinrichtungen vorzugehen. Sie plädierte unter anderem für verpflichtende Fortbildungen für pädagogisches Personal. Lehrer müssten interkulturell kompetent sein. Außerdem brauche es Anlaufstellen für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte. Weil Diskriminierung auch in der Schule stattfinde, sei es wichtig, dass sich Betroffene an eine unabhängige Institution wenden könnten. „Wir sind verantwortlich dafür, dass wir diesen Menschen eine Chance geben, gehört zu werden“, sagte Widmann–Mauz.
So ist es laut Widmann-Mauz ebenso notwendig ein effektiveres Durchgreifen gegen Rassismus und Diskriminierung im Netz. „Hetzer auf den verschiedenen Plattformen müssen spüren, dass der Rechtsstaat bei ihnen vor der Türe steht.“ Nach dem Anschlag von Halle und dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) müsse klar sein, dass Rechtsextremismus, Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit eine reale Gefahr seien, so die Integrationsbeauftragte.
Nachholbedarf sieht Widmann-Mauz aber bei der Bildung von Migranten. So brauche es insbesondere eine bessere Sprachförderung und deutschlandweit verpflichtende Sprachtests für Kinder vor der Einschulung. Frauen benötigten mehr Unterstützung, damit sie auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich sein könnten. Dazu sei eine „Integrationsoffensive“ erforderlich. So seien auch „hochqualifizierte ausländische Frauen seltener erwerbstätig als nicht-ausländische“.
Kritik an der Integrationsarbeit der Bundesregierung kam von der Opposition im Bundestag. Die Sprecherin für Migrations- und Integrationspolitik der Grünen, Filiz Polat, bemängelte: „In Deutschland entscheidet zunehmend der Aufenthaltsstatus über die Möglichkeit und Chance auf wirtschaftliche und gesellschaftliche Teilhabe.“ Zu viele Menschen mit unsicherem Aufenthaltsstatus seien mit Arbeitsverboten konfrontiert sowie vom regulären Schulbesuch und von Integrationsangeboten ausgeschlossen.
Der Linken geht die Umsetzung der Regierung von „wichtigen Vorschlägen zur Arbeitsmarktintegration“ zu langsam. „Für wirkliche Repräsentation unserer Einwanderungsgesellschaft fehlen Menschen mit Migrationsbiografie immer noch etwa in den Führungsetagen im Öffentlichen Dienst“, so deren Fachsprecherin Gökay Akbulut.
Die Union verwies hingegen auf Fortschritte in der Integrationspolitik. Diese Entwicklungen seien „erfreulich, besonders weil der öffentliche Diskurs häufig von Hass und Hetze bestimmt ist und zum Teil ein anderes Bild vermittelt“, so die Integrationsbeauftragte der Unionsfraktion im Bundestag, Nina Warken (CDU). Die Anstrengungen dürften aber nicht nachlassen. „Wir müssen insbesondere bei denen ansetzen, ohne die eine langfristige, erfolgreiche Integration nicht gelingen kann – nämlich bei Frauen und Kindern.“
Laut Bericht ist der Zuwanderungsüberschuss in Deutschland rückläufig. 2018 lag er bei „plus 399.680“, im Jahr zuvor bei plus 416.000. Rund 53 Prozent der Zuwanderer kamen laut Statistik im vergangenen Jahr aus einem EU-Mitgliedsstaat. (KNA/iQ)