









Schlechte Chancen bei der Wohnungssuche wegen schwarzer Haut oder eines Kopftuchs, sexistische Äußerungen auf der Arbeit – täglich sind Menschen Diskriminierung ausgesetzt. Besonders oft geht es um Rassismus.
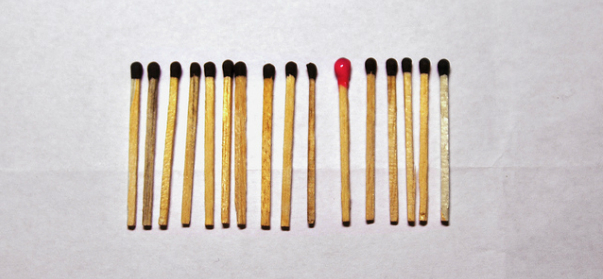
Bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes sind im vergangenen Jahr erneut mehr Hilferufe wegen Diskriminierung eingegangen als im Jahr davor – am häufigsten ging es erneut um rassistische Diskriminierung. Wie der Jahresbericht der Stelle für 2019 zeigt, unterstützte das dortige Beratungsteam in insgesamt 3580 Fällen Menschen, die von Benachteiligung bei Alltagsgeschäften oder am Arbeitsplatz wegen ihres Aussehens, Geschlechts, der Religion oder anderer Faktoren berichteten. 2018 waren es 3455 Fälle. Der Bericht wurde am Dienstag in Berlin vorgestellt.
Jeder dritte Beratungsfall hatte demnach mit rassistischen Diskriminierungserfahrungen zu tun. Die Zahlen in diesem Bereich haben sich den Angaben zufolge seit 2015 mehr als verdoppelt – von 545 auf 1176 (2018: 1070). An zweiter und dritter Stelle folgten Beratungsanfragen wegen Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts (29 Prozent) und wegen einer Behinderung (26 Prozent), danach Benachteiligungen aufgrund des Alters (12), der Religion (7), der sexuellen Identität (4) und der Weltanschauung (2).
Der größte Anteil der berichteten Diskriminierungen geschieht im Beruf oder bei der Jobsuche (36 Prozent). Am zweithäufigsten (26 Prozent) ging es um Benachteiligungen bei Alltagsgeschäften, wie der Wohnungssuche, beim Einkauf, in der Gastronomie oder bei Versicherungs- und Bankgeschäften.
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes berät Betroffene auf Basis des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, bei der Durchsetzung ihrer Rechte, wenn sie beispielsweise aus rassistischen, ethnischen, geschlechtlichen oder religiösen Gründen diskriminiert werden oder wurden. Die Stelle holt auch Stellungnahmen der Gegenseite ein und vermittelt gütliche Einigungen. Die Gesamtzahl der Anfragen bei der Antidiskriminierungsstelle hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht. Im Jahresbericht 2018 wurde das auch damit begründet, dass Betroffene besser über ihre Rechte informiert sind und von der Beratungsmöglichkeit Gebrauch machten.
Nach Auffassung des Leiters der Antidiskriminierungsstelle, Bernhard Franke, schützt das deutsche Gleichbehandlungsgesetz nicht genug vor Diskriminierung. Er forderte Bund und Länder am Dienstag dazu auf, die Rechtsstellung und die Hilfsangebote für Betroffene deutlich zu verbessern und das Gesetz zu reformieren. So müsste die Antidiskriminierungsstelle nicht nur beraten, sondern auch klagen dürfen, zudem brauche es längere Fristen zur Geltendmachung von Ansprüchen und ein Verbandsklagerecht für Antidiskriminierungsverbände.
Die Antidiskriminierungsstelle kritisiert auch eine Passage im Gleichbehandlungsgesetz, die Vermietern weitreichende Möglichkeiten zu Ungleichbehandlungen einräume. So heißt es dort in Paragraf 19: „Bei der Vermietung von Wohnraum ist eine unterschiedliche Behandlung im Hinblick auf die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewogener Siedlungsstrukturen sowie ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnisse zulässig.“
„Deutschland hat ein anhaltendes Problem mit rassistischer Diskriminierung und unterstützt Betroffene nicht konsequent genug bei der Rechtsdurchsetzung“, sagte Franke. „Das Gefühl, mit einer Ungerechtigkeit alleine gelassen zu werden, hat auf Dauer fatale Folgen, die auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden. Diskriminierung zermürbt.“
In der „Welt“ (Dienstag) sprach Franke auch das sogenannte Racial Profiling an – ein gezieltes Vorgehen nach ethnischer oder religiöser Zugehörigkeit, etwa Kontrollen nach Aussehen. Er forderte in allen Bundesländern die Einrichtung von Ombudsstellen bei der Polizei für Opfer solcher Vorgänge. Sie würden deutlich häufiger gemeldet, wenn die Betroffenen eine gezielte Anlaufstelle dafür hätten. Seit der Einsetzung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2006 hätten sich mehr als 200 Menschen dort gemeldet, die der Polizei ein solches Vorgehen vorwarfen. Man gehe davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Fälle viel höher sei. „Für viele Betroffene gehört es zum Alltag, kontrolliert zu werden.“ (dpa/iQ)