









„Gottes falsche Anwälte“. So heißt das neue Buch des Theologen Mouhanad Khorchide. Es geht um den „Verrat am Islam“ und eine „Kultur der Unterwerfung“. Ali Mete hat es gelesen.
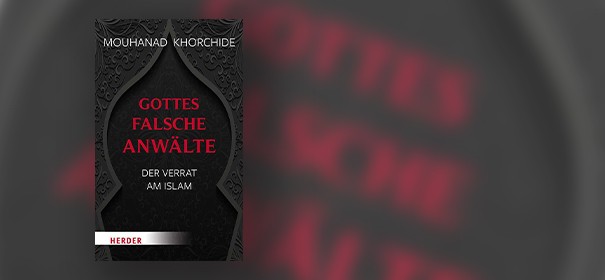
Wenn man das Buch „Gottes falsche Anwälte“ des Münsteraner Theologen Mouhanad Khorchide in wenigen Worten zusammenfassen müsste, könnte man sagen: Ethisierung und Enttraditionalisierung des Islams. Ethisierung deshalb, weil der Autor viele Gebote entweder für heute ungültig bzw. irrelevant erklärt und sich stattdessen auf die ethische Dimension des Islams beschränkt. Enttraditionalisierung deshalb, weil er die Tradition teils ausblendet, teils für verfälscht hält und sich nur in dem selbst festgesetzten Rahmen auf den Koran bezieht.
Die Hauptthese des Buches ist eine umfassende Tahrîf-Theorie: Demnach sei der Islam nach dem Ableben des Propheten Muhammad (s) mehr oder weniger bewusst verfälscht worden. Infolgedessen seien in Lehre und Praxis „Unterwerfungsstrukturen“ entstanden. Diese bestünden bis heute fort und seien schuld an der heutigen Misere der Muslime und der islamischen Länder. Das Buch erweckt den Eindruck, als sei in der islamischen Geschichte und Lehre der Muslime so ziemlich alles falsch gelaufen. Nur ein aufgeklärter Islam könne Abhilfe schaffen.
Ich möchte in diesem Beitrag exemplarisch auf einige theologische und historische Aspekte eingehen, die mir überbetont bzw. verzerrt dargestellt erscheinen. Zudem möchte ich auf auffallende sprachliche Merkmale aufmerksam machen. Beginnen wir mit dem Letzteren.
Wie schon in seinen vorherigen Büchern, verwendet Khorchide bewusst eine populäre Sprache, um mehr Leser zu erreichen. Das ist nachvollziehbar. Doch darüber hinaus ist die Sprache bestimmt von Dichotomien, unterstützt von tendenziösen Schlagwörtern.
Ein Merkmal des Denkens und der Sprache des Autors sind Gegensätze. In diesem Buch sind es z. B.: Gehorsam vs. Freiheit, barmherzig vs. restriktiv, Gebot vs. Ethik, konservativ vs. aufgeklärt, Argument vs. Zwang, Liebesbeziehung vs. Unterwerfungsbeziehung. Für das Ausloten von Positionen und Gedanken sind Dichotomien geeignet. Problematisch ist es, wenn es dabei bleibt. Denn das erschwert es, eine dritte oder vierte Position miteinzubeziehen. Im Buch entsteht der Eindruck als könne es nur einen aufgeklärten oder einen restriktiven Islam geben, Gott könne nur autoritär oder barmherzig sein, und ein gläubiger Mensch könne entweder Gebote befolgen oder ethisch handeln. Alles, was dazwischen ist, bleibt ausgeblendet. Dabei ist doch gerade dieses Dazwischen das Reale, Menschliche.
Ein Beispiel hierfür ist das von Khorchide entwickelte Gottesverständnis. Zum einen ist hier eine Dichotomie zu erkennen: Entweder glaubt man an einen restriktiven oder an einen barmherzigen Gott. Beides wird quasi absolut gesetzt. Zum anderen wird der Schöpfer und sein Geschöpf fast auf eine Stufe gestellt, was in Richtung „Vermenschlichung“ Gottes geht. Natürlich ist Allah, der Barmherzige, Gnädige, Vergebende usw., der dem Menschen näher ist als seine Halsschlagader, wie es im Koran heißt. Das bedeutet aber nicht, dass er in eine „Gemeinschaft“ mit seinen Geschöpfen tritt oder sogar treten muss.
Vielmehr ist das Verhältnis des Muslims zu Gott als eines zwischen „Hawf“ und „Radscha“, also zwischen Furcht und Hoffnung. So wird in der Sure Isrâ von denen gesprochen, die „auf Gottes Barmherzigkeit hoffen und seine Bestrafung fürchten.“ Dies ist dem Gelehrten Ibn Arabi so wichtig, dass er in seinem „Futuhât“ den Gläubigen als jenen bezeichnet, dessen Hoffnung und Furcht ausgeglichen sind. Dieses ausgewogene Verhältnis ist ebenso für Gazâli zentral. Im „Ihyâ“ beantwortet er die Frage, was wichtiger ist, Hoffnung oder Furcht, mit einer Gegenfrage: „Was ist wichtiger, Brot oder Wasser?“.
Die dichotome Sprache des Buches wird unterstützt durch tendenziöse Schlagwörter, die den ganzen Text durchziehen. So ist die Rede von „Herrschern“ und „Machthabern“ – nicht etwa von „Regierenden“ oder „Staatsführern –, die fast immer „autoritär“ oder „restriktiv“ sind, während ihr Gegenpart durchweg „kritisch“, „aufgeklärt“ oder „liberal“. Worum es in dem Buch geht, verdeutlicht nicht zuletzt auch die Häufigkeit bestimmter Wörter: In verschiedenen Variationen kommt „Gewalt“ 46 mal, „Manipulation“ 70 mal und „Macht“ 140 mal vor. Alles in allem findet man also eine sehr deutliche, aber deshalb auch sehr drastische und tendenziöse Sprache vor.
Im ersten Kapitel geht es um politisch-religiöse Macht. Es wird beschrieben, wie nach dem Ableben des Propheten innerarabische Stammesrivalitäten, aber auch die Adaptation sassanidischer, der islamischen Lehre widersprechender Herrschaftsvorstellungen, nach und nach zur Errichtung einer Erbmonarchie geführt haben. Hierhin spielt der Prophetengefährte Muâwiya eine unheilvolle Rolle. Dies sind, aus meiner Sicht, schmerzliche Erfahrungen, die Teil des kollektiven Gedächtnisses der Muslime sind. Heute gilt es selbstkritisch zu fragen, ob und was Muslime aus diesen Erfahrungen gelernt haben.
Der Autor geht aber weiter. Ihm zufolge haben die nachprophetischen Entwicklungen eine Gesellschaft und Theologie, ja eine „Kultur der Unterwerfung“, entstehen lassen, die über die Jahrhunderte bis heute bestehe. Muslime seien darin gefangen und reproduzierten sie sogar, oft ohne zu wissen, dass sie nicht frei sind.
Richtig hieran ist, dass die Politik – Khorchide bevorzugt die Bezeichnung „autoritäre Machthaber“ –, oft versucht, Einfluss auf Religionsgemeinschaften und deren religiöse Lehren zu nehmen. Früher wie heute. Die abbasidischen und umayyadischen Herrscher nutzten lediglich andere Mittel als heutige Regierungen. Eine religiöse Sprache und theologische Argumente waren und sind hierbei besonders beliebt. Übrigens gilt das nicht nur für Länder der islamischen Welt, sondern auch für säkulare Staaten, die direkt oder über Umwege eine bestimmte Lesart des Islams fördern. Nüchtern betrachtet, ist die dramatische und Jahrhunderte islamischer Geschichte ausblendende Darstellung des „Verrats am Islam“ relativ zu sehen, wenn nicht selbst als Verzerrung zurückzuweisen.
Zurecht wird auch festgestellt, dass die Bezeichnung des Gemeinwesens in Medina als „Staat“ irreführend und eine unzulässige Rückprojizierung eines modernen Konzepts sei. Allerdings ist es nunmal so, dass der Prophet vor allem in Medina viele Positionen in sich vereinte. Vermutlich war die Nachfolge auch deshalb so strittig, übernimmt der Kalif doch alle Ämter außer der Prophetenschaft.
Jedoch war es in der damaligen Zeit unmöglich und auch unnötig, „Staat“ und Religion zu trennen, wie es heute in säkularen Staaten, mit verschiedenen Staat-Religion-Beziehungsmodellen, der Fall ist. Der Prophet kann, um einen aktuellen Begriff zu benutzen, nicht nachträglich „entpolitisiert“ werden. Es ist historisch unrealistisch und theologisch nicht haltbar, dass der Gesandte Gottes, wie Khorchide meint, bloß Verkünder der Botschaft gewesen sei, und ansonsten keinen Einfluss auf die Gemeinde gehabt habe. Dabei war er doch die zentrale Figur, vor allem nach dem Abkommen von Medina. Was mit dieser zentralen Sonderstellung des Propheten in späteren Zeiten legitimiert wurde, ist eine andere Frage.
Seltsam klingt in diesem Zusammenhang zudem, wenn der Autor anscheinend demokratische Wahlen im siebten Jahrhundert erwartet. So etwa, wenn er feststellt, dass nur einige wenige in die Wahl Abû Bakrs einbezogen und „alle anderen Muslime“ nicht gefragt wurden, oder bei Muâwiya eine fehlende „Legitimation durch das Volk“ vermisst.
Was in diesem Kontext deutlich zu kurz kommt, sind die Gegenstimmen und -bewegungen, vor allem aus theologischer Sicht. Zum Beispiel weigerte sich Abû Hanîfa, auf den die heute weit verbreitete hanafitische Rechtsschule zurückgeführt wird, zeitlebens, in den Staatsdienst einzutreten. Er wurde festgenommen und gefoltert. Ahmad ibn Hanbal, „Begründer“ der hanbalitischen Rechtsschule und zentrale Referenz der Salafiyya, wurde wegen seines öffentlichen Widerspruchs gegen die vorherrschende Meinung der Mutazila über den Koran eingekerkert. Und auch die beiden anderen Imame der vier bekannten Rechtsschulen, Imam Schafiî und Imam Mâlik, standen im Konflikt mit den Regierenden.
Ebenso bleibt unerwähnt, dass die nachprophetischen Jahrhunderte die Zeit waren, in der Kunst, Kultur und Wissenschaft gefördert wurden und einen immensen Aufschwung erlebten. Diese beiden Aspekte entkräften die Fixierung auf das vom Autor eingebrachte, unterworfene Objektsein der muslimischen Untertanen. Ohne diese Aspekte bekommt der Leser den Eindruck als würde die muslimische Bevölkerung – damals wie heute –, weil sie ja nicht eigenständig denkende und handelnde Subjekte seien, alles über sich ergehen lassen.
Zwischenfazit: Die theologisch-politischen Diskussionen nach dem Ableben des Propheten Muhammad (s) haben sicherlich Spuren hinterlassen und teilweise Weichen gelegt. Aber eine direkte Linie von der nachprophetischen Zeit bis in die Gegenwart zu ziehen und zu folgern, dass „ein Großteil dessen, was wir Muslime heute als islamisch bezeichnen, lediglich Produkt eines politischen Missbrauchs“ sei, ist nicht haltbar. Deshalb hat sich bisher auch kein Wissenschaftler von Rang gemeldet, der diese These mitträgt. Übrigens kritisiert der Autor an anderer Stelle genau diese epochenüberspringende Sichtweise, wenn er schreibt: „Der postsalafistische Islamist versucht einen roten Faden zu ziehen vom einstigen Kolonialismus zu der heutigen Lage der Muslime in der Welt.“
Manchmal ist das Verschwiegene wichtiger als das Gesagte. Vor allem, wenn es zu einer verzerrten Sichtweise des Sachverhaltes führt. So sieht der Autor in der „Rhetorik des Kolonialismus“ bzw. Postkolonialismus eine Ausrede, die von Muslimen oder dem „politischen Islam“ vorgebracht werde, um die Schuld bei anderen zu suchen und nicht bei sich selbst. Doch Kolonialismus als Mittel der Schuldzuweisung zu betrachten, ohne die breit belegten und wissenschaftlich erforschten, immensen Folgen für die kolonisierten Länder auch nur zu erwähnen, ist irreführend. Andere haben die Folgen von Kolonialismus und Dekolonisation zutreffend erkannt, weshalb z. B. langsam eine sehr selbstkritische Beschäftigung mit der kolonialen Vergangenheit Deutschlands begonnen hat, und zwar aus der Mitte der Gesellschaft und Forschung.
Ein anderes Beispiel für das Auslassen relevanter Informationen betrifft die Selbstverortung des Korans. Dieser versteht sich als Fortsetzung der göttlichen Offenbarung, also als Bestätigung von Thora und Evangelium. Wenn man das so versteht, sind Sätze wie „Mohammed sah seine Verkündigung in einer Linie mit dem Judentum und dem Christentum“ folgerichtig. Der Koran ist allerdings nicht nur Bestätigung, sondern auch Korrektur der vorherigen Offenbarungen. Er bestätigt nicht „das Christentum“ und „das Judentum“, sondern nur jene Teile davon, die im Laufe der Zeit nicht verändert wurden.
Obwohl der Autor die islamische Geschichte als eine Art strukturellen Machtmissbrauch zu sehen scheint, versucht er an verschiedenen Stellen, seine Positionen durch Zitate und Verweise auf anerkannte, klassische Gelehrte zu untermauern. Dass dies aber nicht gründlich gemacht wurde, zeigt ein Beispiel von Tragweite, geht es doch immerhin um Himmel und Hölle. Khorchide meint, dass Gazâli, einer der zentralen klassischen Gelehrten, die „koranischen Bilder von Paradies und Hölle nur metaphorisch und nicht wortwörtlich“ verstanden habe.
Hier scheint eine Verwechslung vorzuliegen. Gazâli war der Meinung, dass die Höllenstrafen nicht figurativ oder metaphorisch zu verstehen sind, sondern körperlich. Himmel und Hölle metaphorisch zu deuten, bezeichnet Gazâli am Ende seines bekannten Werkes „Tahâfut al-Falâsifa“ sogar als Unglauben. Gazâli behauptet also das Gegenteil dessen, was ihm der Autor zuschreibt. Der Grund der Verwechselung ist vermutlich, dass, wie man an den Fußnoten dieses Passus erkennt, nicht die arabischen Originalquellen genutzt wurden, sondern deutsche Übersetzungen.
Auch in der Frage, ob Frauen „Imaminnen“ sein können, beruft sich Khorchide, nachdem er Muslimen vorgeworfen hat, ihr eigenes Erbe nicht zu kennen, auf Gelehrte, darunter Ibn Tamiyya. Dieser sehe „kein Problem darin, dass eine Frau als Imamin vor Männern betet.“ Tatsächlich ist Ibn Taymiyya dieser Meinung. Allerdings beschränkt er dies nur auf Notfälle, wenn kein geeigneter Mann vorhanden ist. Eine unerwähnte, aber wichtige Einschränkung, die ein ganz anderes Licht auf die Frage wirft.
Neben der umstrittenen Frage, ob Frauen einer gemischtgeschlechtlichen Gemeinschaft als „Imaminnen“ vorstehen können, gibt es noch eine Reihe anderer theologischer Positionen, die problematisch sind, in diesem Beitrag aber nicht behandelt werden können. Dazu zählen die Relativierung des Fastens, des Kopftuchgebotes sowie anderer religiöser Praktiken und Normen, die Ablehnung der Gültigkeit einzelner Koranverse, die recht freie, lebensberatermäßige „Exegese“ der Sure Fâtiha, die Stellung von Juden und Christen im Jenseits und die Bezeichnung der Offenbarung als unabgeschlossene Kommunikation.