




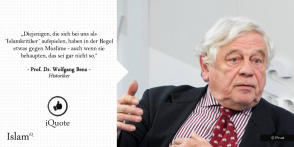
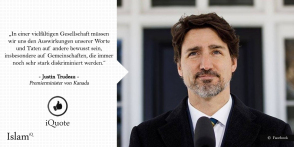

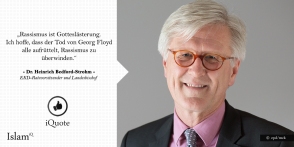

Gläubige Menschen sind einer Studie zufolge nicht per se Verschwörungstheoretiker. Die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde scheint sogar vor den Mythen zu schützen.

Der Glaube an Verschwörungsmythen hängt einer Studie zufolge mit der Einstellung zur eigenen Religion zusammen. Teilnehmer einer Online-Umfrage, die hinter der Pandemie verborgene Mächte am Werk sahen, hatten eher ein exklusives Verständnis von Religion, wie die Münsteraner Politikwissenschaftlerin Carolin Hillenbrand am Montag der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) erklärte. Das bedeutet, dass sie Aussagen wie „Meine Religion ist die einzig akzeptable“ und „Wenn sich Religion und Wissenschaft widersprechen, ist die Religion im Recht“ zustimmten. In Hillenbrands nicht-repräsentativer Untersuchung bejahten vor allem evangelikal-freikirchliche Christen diese Sätze.
Die Wissenschaftlerin lehnt die Aussage ab, dass Religiosität grundsätzlich den Glauben an Verschwörungsmythen befördere. Es gehe eher um Persönlichkeitsmerkmale, die sowohl die Haltung zu Religion als auch zu Verschwörungsmythen prägten. Das zeigten auch Ergebnisse aus anderen Untersuchungen. Menschen, die zum Beispiel schlechter mit Unsicherheiten umgehen könnten, würden „angezogen einerseits von eher fundamentalistisch-dogmatischen Glaubensrichtungen, aber auch gleichzeitig von diesen Verschwörungsmentalitäten“.
Nach den Worten der Forscherin liegt dem Verschwörungsglaube meist eine pessimistische Weltsicht zugrunde. „Da gibt es keine Erlösungsvision – und das bringen die Religionen eigentlich immer mit“, sagte sie. So ende die Erzählung des Christentums eben nicht mit dem Tod Jesu am Kreuz, sondern mit seiner Auferstehung.
Auch unter den Muslimen haben laut Hillenbrand viele ein exklusives Verständnis von Religion. Allerdings stimmten Muslime dem Satz „Hinter der Corona-Pandemie stecken böse, verborgene Mächte“ im Gegensatz zu evangelikal-freikirchlichen Christen eher nicht zu. Auch Katholiken und Protestanten hingen dieser Erzählung nicht an. Menschen hingegen, die juden- und islamfeindliche Einstellungen aufzeigten, schenkten dem Mythos von den bösen Mächten im Hintergrund oft Glauben. Studienteilnehmer, die vor allem das private Gebet pflegten, zeigten sich auch für die Erzählung anfällig – anders als diejenigen, die Gottesdienste besuchen und in Gemeinschaften eingebunden sind.
Hillenbrand, die am Exzellenzcluster „Religion und Politik“ der Universität Münster forscht, bezieht sich in der Studie auf die Daten von 2.032 Teilnehmenden, die zwischen Juli und Dezember vergangenen Jahres ihren Online-Fragebogen ausfüllten. Mitgemacht hatten 911 Katholiken, 440 Protestanten, 199 evangelikal-freikirchliche Christen, 82 Muslime, 257 Nicht-Religiöse und 80 Menschen, die sich als spirituell bezeichnen, aber keiner Religion angehören. Der Rest hatte eine andere Religion oder machte keine Angaben.
In einer ersten Auswertung ihrer Umfrageergebnisse zwischen Juli und Oktober war Hillenbrand zu dem Ergenis gekommen, dass die Corona-Krise offenbar die Glaubensfestigkeit beeinflusst. So sei die Religiosität gläubiger Christen zwischen Juli und Oktober oftmals angewachsen, während Menschen ohne Religion eher noch weniger Zugang zum Glauben gefunden hätten als zuvor.
„Ich glaube, wenn man eine gefestigte Beziehung hat, kann die auch genau in Krisen-Zeiten tragen“, erklärte Hillenbrand. Menschen, die schon vor der Krise nicht religiös waren, könnten hingegen zu der Überzeugung gelangt sein, dass es angesichts von Corona keinen guten Gott gebe. Möglicherweise reagierten Nicht-Gläubige auch negativ auf wieder geöffnete Kirchen, während viele andere Einrichtungen erneut schließen mussten. Der Fragebogen ist nach wie vor online auf den Seiten des Exzellenzclusters „Religion und Politik“ erreichbar. Die Forscherin hofft, mehr Angehörige weiterer Religionsgruppen, etwa Juden, zu erreichen. (KNA/iQ)