




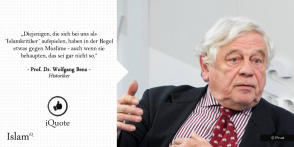
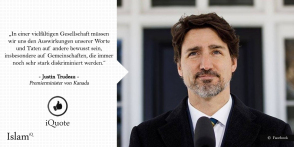

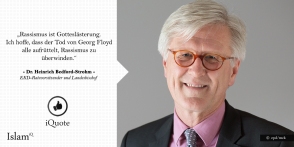

Mit einer Ausstellung will sich die Stadt Jena mit ihrer Rolle beim Aufkommen des NSU und Rechtsextremismus beschäftigen.

Die Ausstellung mit dem Titel „End.Täuschung – Rechtsextremismus. Irritation. Ausstieg“ läuft im Rahmen der Reihe „Kein Schlussstrich! Jena und der NSU-Komplex„. Mit der Serie will sich die Stadt Jena mit ihrer Rolle beim Aufkommen des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) beschäftigen. Die Haupttäter Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe kommen aus der Stadt. Im Rahmen der Serie finden daher seit Juni Ausstellungen, Podien oder Vorträge statt. Mit der aktuellen Ausstellung, die seit dem Wochenende im Stadtmuseum zu sehen ist, soll dem ein Stück weit entgegentreten werden. Sie widmet sich Radikalisierungsprozessen und dem Thema Ausstieg aus der rechten Szene und ist einen Monat lang kostenfrei zu sehen.
Die Ausstellung im Stadtmuseum nähert sich dem Thema mit elf Tafeln an, die verschiedene Aspekte des Ausstiegsprozesses abbilden: Vom Einstieg über rechte Musik und Kleidung bis hin zu ersten Irritationen und dem Ausstieg an sich. Auch eine Auseinandersetzung mit Opfern rechter Gewalt findet statt – das sei auch Teil der Aussteigerberatung, sagte Jende: „Dass sich die Leute auch bewusst werden, was ihre eigene Gewalt angerichtet hat.“ Auch bei dem Aussteigerprogramm zurückgegebene Nazi-Kleidung, CDs und andere Objekte werden im Stadtmuseum gezeigt.
Rechtsextreme nutzen aus Sicht einer Aussteigerinitiative die Corona-Krise, um ihre Botschaften unters Volk zu bringen und Menschen in rechtsradikale Kreise zu ziehen. „Die wollen auch gezielt Menschen aus dem Wutbürger-Lager auf ihre Seite bringen“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Jenaer Vereins Drudel 11, Sebastian Jende, anlässlich einer Ausstellungseröffnung im Jenaer Stadtmuseum. Als Beispiel nannte er den Thüringer Rechtsextremisten Tommy Frenck, der auf seinem Kanal beim Messengerdienst Telegram Corona-Nachrichten zusammen mit rechtsextremen Inhalten verbreite. Sorgen mache dem Verein zudem, dass in der Lockdown-Zeit viele Jugendliche, mit denen der Verein zur Extremismus-Prävention zusammenarbeitet, nicht mehr erreichbar waren. Auch im Internet, wo Radikalisierungsprozesse stattfinden, seien Jugendliche schwieriger zu erreichen als etwa bei der Arbeit mit Schulklassen. (dpa, iQ)