







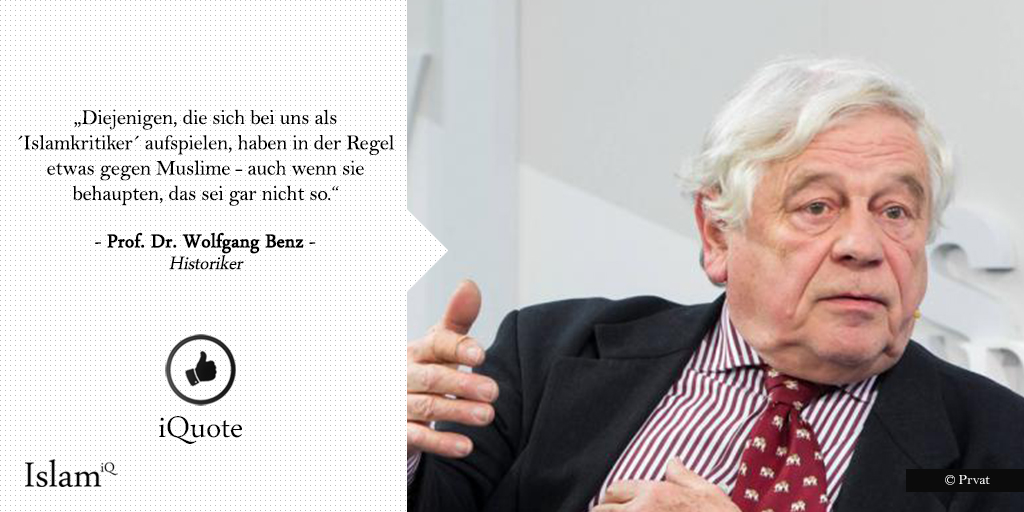

Eine herablassende Behandlung bei der Behörde, eine Kontrolle in der U-Bahn wegen der Hautfarbe. Wer sich diskriminiert fühlt, kann sich in Berlin auf ein eigenes Gesetz berufen. Hunderte Menschen haben das bereits getan.

Das Berliner Antidiskriminierungsgesetz (LADG) hat nach Angaben der zuständigen Ombudsstelle bislang zu rund 1000 Beschwerden geführt. Zwei große Themen bei den nach dem Gesetz als berechtigt eingestuften etwa 700 Fällen sind: Barrierefreiheit und Rassismus. „Die Beschwerden helfen uns, als Behörde besser zu werden“, sagte die Leiterin der Ombudsstelle, Doris Liebscher. „Diskriminierung ist ein relativ normales Phänomen in unserer Gesellschaft„, so Liebscher. Mit dem LADG verfolge Berlin einen professionellen Umgang damit. „Wir wollen über den Einzelfall an die Strukturen ran, um so als Behörde professioneller werden zu können.2
Das Thema Barrierefreiheit spielt vor allem bei den Beschwerden über die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) eine große Rolle. „In diesem Bereich muss aber auch die gesamte Berliner Verwaltung noch ganz viel machen“, betonte Liebscher. Das gelte auch für Gebärdendolmetscher. Diese müssten mitunter mühsam ausfindig gemacht werden in entsprechenden Fällen.
Berlin ist bislang das einzige Bundesland, das ein eigenes Antidiskriminierungsgesetz hat. Es soll die Menschen in der Hauptstadt vor Diskriminierung seitens der Behörden schützen und Ansprüche auf Schadenersatz gegen das Land Berlin ermöglichen. Seit gut zwei Jahren gibt es das Gesetz. Wer sich diskriminiert fühlt, kann sich an die betroffene Behörde wenden oder an die Ombudsstelle, die seit Oktober 2020 bei der Justizverwaltung angesiedelt ist. Dann wird der Vorwurf geprüft und zunächst nach Lösungen jenseits von Klagen gesucht. Betroffene werden aber auch bei Klagen unterstützt.
Bei der Ombudsstelle gibt es laut Liebscher von Beginn an viel zu tun. „Das hat sehr viel damit zu tun, dass wir hier in Berlin eine hervorragende Beratungsinfrastruktur haben, wo sich die Menschen schon zuvor hingewandt haben und sehr professionell beraten wurden“, meinte sie. „Darüber wurde die Ombudsstelle sehr schnell in der Zivil- und Stadtgesellschaft bekannt und angenommen.“
Ein Großteil der Beschwerden bezogen sich bislang auf Vorfälle bei den Bezirksämtern in Berlin. Die Beschäftigten dort arbeiteten teils unter angespannten Situationen, erklärte Liebscher. Dies sei durch die Corona-Pandemie oftmals verstärkt worden. „In stressanfälligen Situationen entsteht dann oft Diskriminierung. Das ist ein Muster das ich ausgemacht habe.“
Viele Beschwerden gab es auch zu Vorfällen in den Schulen, auf Platz drei landeten die Polizei und die Senatsverwaltung für Gesundheit, deren Agieren von vielen Menschen in der Corona-Pandemie kritisiert wurde. Kurz dahinter rangiert die BVG.
Neben der Barrierefreiheit werde vor allem das Verhalten von Busfahrern kritisiert – und von Kontrolleuren. Ein mutmaßlicher Fall von Rassismus bei einer Fahrkartenkontrolle beschäftigt die Berliner Justiz. Ein Fahrgast klagt auf eine Entschädigung und beruft sich auf das LADG. Der schwarze Sänger war nach einem Bericht der britischen Zeitung „The Guardian“ im Oktober 2020 bei einer Kontrolle in der U2 rassistisch angesprochen und geschubst worden. Ein Termin zur mündlichen Verhandlung ist beim Amtsgericht Mitte für den 10. Oktober geplant, wie ein Gerichtssprecher sagte.
Nach Angaben der BVG gibt es regelmäßige Schulungen für interne und externe Mitarbeiter. Diese seien in den vergangenen Jahren, auch aufgrund der aktuell diskutierten Fälle, intensiviert worden. Seit Ende 2021 trage auch das externe Kontrollpersonal blaue Westen oder Dienstkleidung, dies wirke deeskalierend.
Die Leiterin der Ombudsstelle sieht weiteren Handlungsbedarf: „Durch das Auslagern von Tätigkeiten entgleitet uns die Kontrolle.“ Die BVG könne nicht überprüfen, in welchem Umfang die gezielten Schulungen bei Subunternehmen erfolgten. „BVG-Personal muss als Dienstleister des Landes jedoch professionell, also auch diskriminierungsfrei handeln“, betonte Liebscher. Aufgrund des Kostendrucks erscheine es vielleicht günstiger, Aufgaben auszulagern. „Perspektivisch erspart uns die Festanstellung aber Geld, wenn Mitarbeitende die Haltung des Landes Berlin angemessen repräsentieren“, meinte Liebscher. (dpa/iQ)