







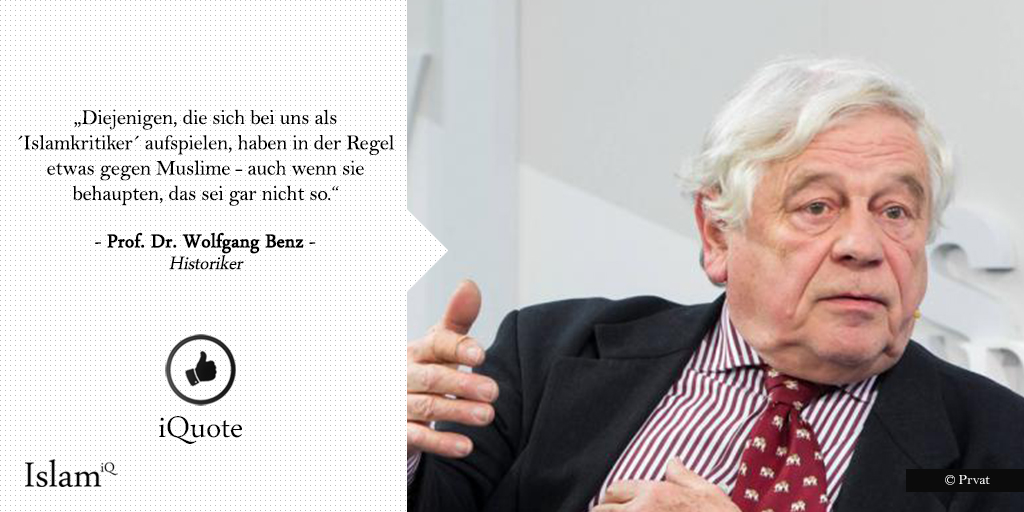

Eine neue Studie zeigt, dass polizeiliche Arbeitsprozesse in Niedersachsen rassistische Diskriminierung begünstigen, besonders bei anlasslosen Kontrollen.

Eine aktuelle Studie der Polizeiakademie Niedersachsen, die von der Robert Bosch Stiftung gefördert wurde, wirft ein neues Licht auf strukturelle Probleme in der Polizeiarbeit. Die Autoren, Dr. Astrid Jacobsen und Dr. Jens Bergmann, haben in ihrer Untersuchung alltägliche Arbeitsroutinen und Prozesse im Polizeialltag analysiert, um potenzielle Risiken fürDiskriminierung zu identifizieren.
Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass rassistische Diskriminierung nicht primär durch individuelle Vorurteile einzelner Beamter ausgelöst wird, sondern in den Strukturen und Prozessen der Polizeiarbeit verankert ist. Konkret fanden die Forscher zwölf kritische Momente in polizeilichen Abläufen, die Diskriminierung begünstigen können. Fünf davon betreffen rassistische Diskriminierung.
Besonders problematisch sind dabei anlasslose Kontrollen, bei denen äußere Merkmale wie Hautfarbe oder ethnische Zugehörigkeit als Grundlage für Verdachtsmomente dienen.
Diese Praxis führt laut der Studie häufig zu einem „polizeilichen Tunnelblick“, bei dem Personen, die aufgrund ihres Erscheinungsbildes als verdächtig gelten, ins Visier der Polizei geraten. Menschen, die nicht dem Täterprofil entsprechen, bleiben dabei oft unbeachtet. Dies verstärke bestehende Vorurteile und bestätige die falsche Annahme, dass bestimmte ethnische Gruppen stärker mit Kriminalität in Verbindung stünden.
Die Studie hebt hervor, dass es sich hierbei um systembedingte Probleme handelt, die unabhängig von der individuellen Einstellung der Beamten auftreten. Die Autoren plädieren für eine Überarbeitung der polizeilichen Arbeitsroutinen, um strukturelle Diskriminierung zu verhindern und eine reflektierte Polizeiarbeit zu gewährleisten.