




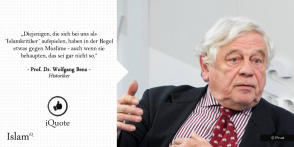
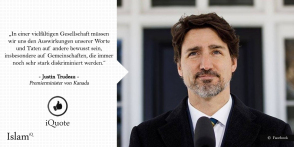

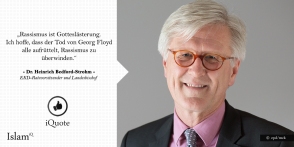

Bei einer Gedenkveranstaltung wird an die Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau erinnert. Hinterbliebene, Politiker und Muslime ergreifen das Wort.

Fünf Jahre nach dem rassistischen Anschlag in Hanau haben Familien und Freunde der Toten gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Vertretern des Landes Hessen und der Stadt Hanau an die neun Opfer erinnert. Bei einer Gedenkstunde vor rund 400 geladenen Gästen riefen Steinmeier und Hinterbliebene zum Zusammenhalt der Gesellschaft und zum Kampf gegen Rassismus und Extremismus auf. Der Anschlag war nach Ansicht Steinmeiers „ein Anschlag auf unsere offene Gesellschaft und unsere liberale Demokratie“. Das gelte auch für die „vermutlich islamistisch motivierten Anschläge der vergangenen Monate“.
Steinmeier sprach sich für ein entschiedenes Vorgehen gegen Rassismus, Rechtsextremismus, Islamismus „und gegen jede andere Form der Menschenfeindlichkeit“ aus. „Es ist an uns, für ein gutes Miteinander zu sorgen, jeden Tag und immer wieder aufs Neue. Das ist die Botschaft, die wir heute hier aus Hanau in unser Land senden sollten.“ Am 19. Februar 2020 hatte ein deutscher Täter in Hanau neun junge Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Die Morde von Hanau seien „nicht aus dem Nichts geschehen“, betonte das Staatsoberhaupt. Zur Vorgeschichte gehöre auch der vor allem im Internet und in den sozialen Medien verbreitete Hass, der darauf abziele, das gesellschaftliche Klima zu vergiften und Abgrenzung und Ausgrenzung von Menschen mit Einwanderungsgeschichte zu vertiefen.
Bei der Gedenkstunde sprachen auch vier Hinterbliebene. Sie forderten ebenfalls, Rassismus und Menschenfeindlichkeit zu bekämpfen – aber auch eine restlose Aufklärung der Tatumstände und personelle Konsequenzen für die damals Verantwortlichen. Direkt nach Steinmeier ergriff Emis Gürbüz, Mutter des ermordeten Sedat Gürbüz, das Wort. „Dieses Ereignis ist ein schwarzer Fleck in der Geschichte der Stadt Hanau und Deutschlands“, sagte sie über den Anschlag. Die Stadt Hanau trage die Hauptschuld, sagte Gürbüz unter Verweis auf Briefe, die der spätere Täter vor dem Attentat verschickt habe und auf den versperrten Notausgang in einer Bar, die am Abend des 19. Februar 2020 zum Tatort wurde. Die Entschuldigung des neuen hessischen Innenministers Roman Poseck (CDU) für Fehler in der Polizeiarbeit in der Tatnacht wolle sie nicht annehmen, betonte Gürbüz. „Es hätte keine Fehler, Versäumnisse oder Fahrlässigkeiten geben dürfen. „Ich akzeptiere keine Entschuldigung“, betonte die Mutter. Poseck war im Jahr 2020 noch nicht Innenminister.
Den kürzlich zwischen der Mehrheit der Hinterbliebenenfamilien und der Stadt Hanau gefundene Kompromiss zur Errichtung eines Denkmals am Platz vor dem geplanten Haus für Demokratie und Vielfalt in Hanau lehnt Gürbüz ab. „Ich möchte nicht, dass der Name meines Sohnes darauf erscheint.“ Sie hält nach wie vor den Marktplatz für den besseren Standort. Ähnlich hatte sich zuvor auch Armin Kurtovic, Vater des ermordeten Hamza Kurtovic, geäußert, der nicht an der offiziellen Gedenkveranstaltung teilnahm. Der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) sagte, die Tat habe eine Wunde in die Stadt geschlagen, die vernarbe, aber nicht verschwinde. Auf die Vorwürfe von Gürbüz ging er in seiner Rede nicht direkt ein. „Wir wissen um die anderen Stimmen und unsere Hand bleibt ausgestreckt“, sagte er mit Blick auf den Streit um den Standort des Mahnmals. Nach Ansicht des hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU) tragen alle Bürgerinnen und Bürger dafür Verantwortung, dass Hass und Hetze die Gesellschaft nicht unwidersprochen spalten könnten. „Hass ist eine reale Gefahr. Und leider müssen wir heute – fünf Jahre später – ehrlich sagen: Er ist es bis heute. Er ist sogar teilweise ein politisches Geschäftsmodell», sagte Rhein.
„Wir müssen uns die Namen der Opfer immer wieder ins Gedächtnis rufen, um nicht zu vergessen, dass es sich um Menschen mit Träumen, Plänen und einer Zukunft handelte. Diese Opfer, diese jungen Menschen, sind nicht nur Zahlen in einer Statistik, sondern ein Symbol für die Gefahr des rassistischen Hasses, dem viele in unserer Gesellschaft ausgesetzt sind.“, heisst es in der Pressemitteilung des Islamrats. Es gebe weiterhin Ungereimtheiten in der Aufarbeitung des Falles. Den Familien solle das nötige Gehör geschenkt werden. Ihre Fragen seien weiterhin nicht vollständig beantwortet. „Fünf Jahre nach dem Attentat haben wir den Eindruck, dass wichtige Lehren nicht gezogen wurden. Der Diskurs über Rassismus und Diskriminierung ist nicht nur weiter eskaliert, er wurde auch zunehmend salonfähig gemacht.“, so Kesici. Täglich würden Menschen mit Migrationshintergrund und Muslime diskriminiert, angegriffen und marginalisiert. Demonstrationen der letzten Wochen und Monate zeigen, dass der Großteil der Bevölkerung diese Entwicklung verurteilt. Die nötige und lautstarke Empörung seitens der Politik bleibe jedoch häufig aus. Das Vertrauen in die Politik würde bröckeln.
Kesici kritisiert insbesondere den Umgang mit Rassismus in der politischen Kommunikation. Es sei ein erschreckender Rückschritt, dass rechtsextremes Vokabular nicht mehr nur in bestimmten Kreisen, sondern auch in der breiten politischen Diskussion auf Zustimmung stoße. „Wir erleben, wie Wahlkampfstrategien auf den Rücken von Migranten und Geflüchteten ausgetragen werden, wenn etwa symbolisch Rückflugtickets für Migranten verteilt werden, ohne dass dies breite politische Verurteilung auslöst.“ Ein weiteres beunruhigendes Signal sei die politische Landschaft im Hinblick auf den Umgang mit Rassismus im aktuellen Wahlkampf. Rassismus und Diskriminierung fänden kaum noch Platz in Wahlkampfdebatten. Stattdessen konzentriere man sich darauf, rechtslastige Stimmen für die eigene Partei zu gewinnen.
Das Gedenken allein reiche nicht, sagt der Generalsekretär der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüş (IGMG) Ali Mete in eine Pressemitteilung, ohne Gerechtigkeit werde Erinnerung zum leeren Ritual. Die Hinterbliebenen verdienten nicht nur Mitgefühl, sondern auch Gerechtigkeit. Doch bis heute warteten sie auf Antworten – und auf Konsequenzen. „Hanau war eine Zäsur. Ein Verbrechen, das auf tragische Weise verdeutlicht, dass rassistische Gewalt in Deutschland kein Einzelfall ist, sondern eine wiederkehrende Realität. Hanau steht in einer traurigen Kontinuität mit Solingen, Mölln, Rostock-Lichtenhagen oder der NSU. Mit Erschrecken müssen wir feststellen, dass die politische und institutionelle Aufarbeitung weiter lückenhaft bleibt.“, so Mete. Fünf Jahre nach Hanau gebe es keine personellen Konsequenzen: „Kein einziger Verantwortlicher, weder aus der Politik noch aus dem Sicherheitsapparat, wurde benannt oder zur Rechenschaft gezogen, obwohl nachweislich Fehler gemacht wurden – Fehler, die Menschenleben gekostet haben.“ (dpa, iQ)