




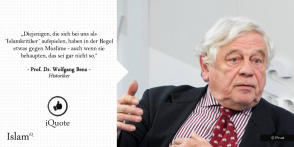
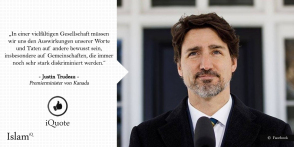

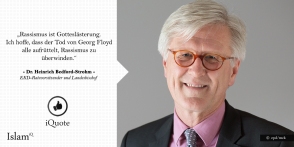

Wie verbreitet ist Rassismus in der Polizeiarbeit? Eine neue Studie untersucht Diskriminierungserfahrungen – und will ein lange unterschätztes Problem in den Fokus rücken.

Die Goethe-Universität Frankfurt am Main und die Polizeiakademie Hamburg haben eine wissenschaftliche Studie zu Rassismus und Diskriminierung im Polizeikontakt gestartet. Eine repräsentative Befragung des Integrationsbarometers des Sachverständigenrates für Integration und Migration hat ergeben, dass als fremd wahrgenommene Befragte etwa doppelt so häufig von der Polizei kontrolliert werden wie andere. Diesen Befund nehmen die Forschenden zum Anlass, um polizeiliches Handeln genauer zu untersuchen.
„Über Rassismus und Diskriminierung in der polizeilichen Arbeit außerhalb von Personenkontrollen wissen wir aber viel zu wenig“, erklärt Tobias Singelnstein, Kriminologe und Strafrechtler an der Goethe-Universität.
Ziel der Studie sei es, die Ergebnisse aus einer groß angelegten Bevölkerungsbefragung mit den Einschätzungen von Polizeibeamtinnen und -beamten zusammenzuführen. Bislang seien Betroffenenerfahrungen und polizeiliche Wahrnehmungen oft getrennt voneinander untersucht worden.
Die gemeinsam mit Eva Groß, Professorin für Kriminologie und Soziologie an der Polizeiakademie Hamburg, initiierte Studie soll diese Erkenntnislücke schließen. Das auf drei Jahre angelegte Forschungsprojekt wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit rund 630.000 Euro gefördert. Zehn Forschende sind beteiligt.
Vom 3. März bis 3. April 2025 läuft zunächst eine repräsentative Bevölkerungsbefragung. Dafür wurden per Stichprobenziehung aus den Einwohnermelderegistern von fünf Großstädten – Berlin, Frankfurt am Main, Dresden, Hamburg und München – 100.000 Personen ausgewählt, die nun einen Online-Fragebogen erhalten. „Je höher die Rücklaufquote ist, desto präzisere Aussagen zur Problemlage können wir treffen“, betont Groß. Ergänzt wird die Befragung durch 60 qualitative Interviews mit Polizeivertreterinnen und -vertretern sowie zivilgesellschaftlichen Akteuren.
Dass das Thema Rassismus in der Polizei hochaktuell ist, zeigt ein jüngster Fall in Hamburg. Dort laufen derzeit Ermittlungen gegen 15 Polizisten, die in Chatgruppen rassistische und nationalsozialistische Inhalte geteilt haben sollen. In mehreren Bundesländern gab es zuletzt ähnliche Fälle. Diese Vorfälle verdeutlichen, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt, sondern um ein strukturelles Problem, das weiter untersucht werden muss. Die neue Studie soll dazu beitragen, ein umfassenderes Bild über Diskriminierungserfahrungen im Polizeikontakt zu gewinnen. (dpa, iQ)