




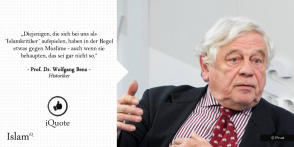
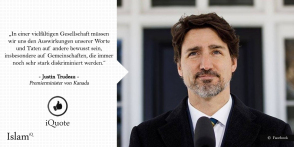

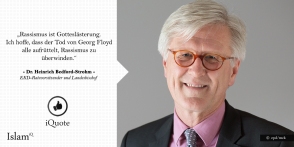

Der neue Koalitionsvertrag setzt Prioritäten. Manche Themen sucht man jedoch vergeblich – etwa das muslimische Leben in Deutschland. Die wichtigsten Punkte im Überblick.

Union und SPD haben sich auf einen Koalitionsvertrag verständigt, der zentrale politische Weichenstellungen für die kommende Legislaturperiode enthält. Bei der gemeinsamen Vorstellung am Mittwochnachmittag in Berlin betonten die Parteivorsitzenden Friedrich Merz (CDU), Saskia Esken und Lars Klingbeil (SPD) sowie CSU-Chef Markus Söder die Schwerpunkte Migration, Wirtschaft und Verteidigung.
In sicherheitspolitischer Hinsicht kündigt die neue Bundesregierung die konsequente Bekämpfung von Extremismus an – namentlich von Rechtsextremismus, “Islamismus” und Linksextremismus. Mit einem neuen Bund-Länder-Aktionsplan gegen “Islamismus” und der Verstetigung der „Task Force Islamismusprävention“ im Bundesinnenministerium sollen entsprechende Maßnahmen institutionalisiert werden. Ergänzt wird dies durch eine geplante Offenlegungspflicht der Finanzierung von religiösen Vereinen, sofern Verbindungen zu ausländischen Regierungen oder eine Beobachtung durch Verfassungsschutzämter vorliegt.
Während diese Vorhaben den Bereich religiös motivierter Radikalisierung adressieren, bleibt das muslimische Alltagsleben in Deutschland im Koalitionsvertrag weitgehend unerwähnt. Es finden sich keine spezifischen Aussagen zur Förderung islamischer Religionsgemeinschaften, zur Anerkennung muslimischer Feiertage, zum islamischen Religionsunterricht oder zum Schutz muslimischer Einrichtungen. Auch der Begriff antimuslimischer Rassismus, der in den vergangenen Jahren verstärkt in politischen Debatten und wissenschaftlichen Analysen aufgegriffen wurde, kommt im Vertrag nicht vor.
Im Gegensatz dazu bekennt sich die neue Koalition zur Staatsräson gegenüber Israel, kündigt den Ausbau von Antisemitismusprävention an und plant ein NSU-Dokumentationszentrum in Nürnberg. Die Sicherheit jüdischer Bürgerinnen und Bürger sowie der Schutz jüdischer Einrichtungen wird als staatliche Aufgabe hervorgehoben.
Vor dem Hintergrund des Gaza-Kriegs und des Terrorangriffs der Hamas vom 7. Oktober 2023 erneuert die Koalition ihr Bekenntnis zur Sicherheit Israels. Das Existenzrecht des Staates sei Teil deutscher Staatsräson, heißt es. Zugleich wird betont, dass die humanitäre Lage im Gazastreifen verbessert werden müsse. Eine langfristige Lösung des Nahostkonflikts werde weiterhin in einer verhandelten Zweistaatenlösung gesehen. Die zukünftige Unterstützung für das UN-Hilfswerk UNRWA soll von Reformen abhängig gemacht werden.
Auch in der Migrations- und Integrationspolitik setzt die Koalition neue Akzente. Die von der vorherigen Regierung eingeführte Möglichkeit zur beschleunigten Einbürgerung besonders gut integrierter Menschen soll wieder abgeschafft werden. Die reguläre Wartefrist von fünf Jahren bleibt bestehen. Der Doppelpass bleibt erlaubt. Vorschläge, eingebürgerten Personen mit Mehrstaatigkeit die deutsche Staatsangehörigkeit bei Extremismus entziehen zu können, wurden verworfen.
Der Koalitionsvertrag stellt sicherheitspolitische Fragen und die Bekämpfung von Extremismus in den Vordergrund. Während die Förderung jüdischen Lebens klar verankert ist, bleibt muslimisches Leben in Deutschland weitgehend unbeachtet. Die Koalition verzichtet auf konkrete Vorhaben zur Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe von Musliminnen und Muslimen – eine Leerstelle, die in der politischen Diskussion Beachtung finden dürfte.