







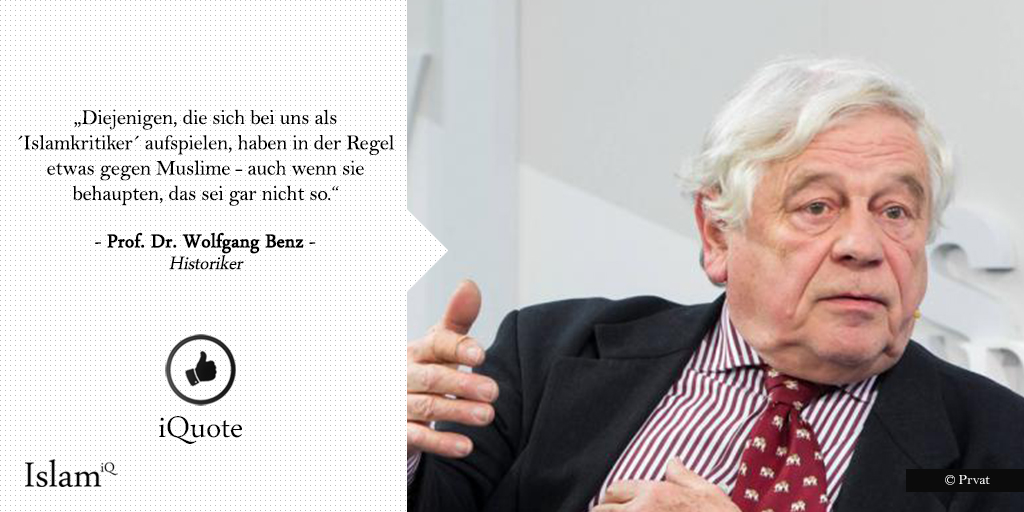

Immer mehr Muslime lassen sich in Deutschland bestatten. Deutsche Friedhöfe werden zunehmend multikultureller. Bestatter begrüßen diese Entwicklung.

Es gibt sie vom hohen Norden bis zu den Voralpen: Friedhöfe, auf denen Christen, Muslime oder Buddhisten gemeinsam bestattet werden. Friedhöfe sollten die plurale Gesellschaft widerspiegeln, wie der Geschäftsführer des Kuratoriums Deutsche Bestattungskultur in Düsseldorf, Oliver Wirthmann, sagt. Für ihn ein „Thema der Zukunft“.
Die Koexistenz auch im Tod wird mancherorts schon seit Jahrzehnten praktiziert. Etwa in der alten Handelsstadt Hamburg, wo Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, Kulturen und Religionen ankamen und mitunter blieben. „Einige sind so verwurzelt, dass sie in mehreren Generationen hier gelebt haben“, erklärt der Sprecher der Hamburger Friedhöfe, Lutz Rehkopf. So gebe es in Ohlsdorf eine der ältesten muslimischen Grabstätten in Deutschland, sie ist von 1941.
Auf dem größten Parkfriedhof der Welt mit 391 Hektar könnten Muslime heute mit dem Kopf in Richtung Mekka auch ohne Sarg bestattet und Leichen in Waschräumen vorbereitet werden. In Ohlsdorf seien 2014 exakt 49, im Jahr davor 44 Muslime beerdigt worden. Nimmt man andere Friedhöfe der Stadt dazu, habe sich die Zahl in den vergangenen 20 Jahren vervierfacht, rechnet Rehkopf vor.
Doch damit nicht genug. „Wir haben auch buddhistische Einzelgräber.“ Auf eine lange Tradition gingen auch die Grabstätten des Chinesischen Vereins, der Japanischen Kolonie und des Deutsch-Baltischen Friedhofsvereins zurück. „Multikulti“ ist auf dem kommunalen, überkonfessionellen Ohlsdorfer Friedhof Teil des Konzeptes. „Es wird rundum akzeptiert“, sagt Rehkopf.
So weit ist man aber nicht überall. „Der Friedhof muss individueller werden“, meint Wirthmann, der auch für den Bundesverband Deutscher Bestatter spricht. Vorschriften für die Höhe von Grabsteinen, starre Nutzungsfristen – „das sind Dinge, die den Friedhof unattraktiv machen“. Warum also nicht auch mal Grabfelder mit weit größerem Gestaltungsspielraum, fragt der Theologe. „Veränderungen sind eine notwendige Zumutung.“
Darauf müssen sich auch die Besucher des kommunalen Heidefriedhofs in Dresden einstellen. Ende September wurde dort eine buddhistische Grabstätte eröffnet, es ist den Angaben zufolge die erste dieser Art in der Region. Im westfälischen Hamm gibt es seit Anfang Oktober ein Hindu-Grabfeld mit Platz für zunächst rund 500 Urnengräber. In der Stadt steht der Sri-Kamadchi-Ampal-Tempel.
Seit etwa vier Jahren können Muslime im bayerischen Penzberg auf einem eigenen Grabfeld bestattet werden, wie der Vorsitzende der Islamischen Gemeinde, Bayram Yerli, berichtet. Der städtische Friedhof habe Platz für 50 muslimische Gräber. Die christlich geprägte Bevölkerung sei an kulturelle Andersartigkeiten gewöhnt, sagt Yerli. Penzberg als Bergwerksort habe immer Migranten angezogen. „Wir haben eine sehr gedeihliche Zusammenarbeit mit den Kirchen.“
Aber wie ist es mit den kirchlichen Gottesäckern? Das Erzbistum Köln etwa erläutert, dass eine Gemeinde einer nicht-katholischen Bestattung zustimmen müsse. „Dieses ist in der Regel aber kein Problem und wird grundsätzlich nicht versagt werden“, erklärt Pressereferentin Sarah Meisenberg. Wenn es in einem Ort nur einen katholischen Friedhof gibt, habe ohnehin jeder das Recht auf eine Bestattung. Denn auch Bestattungen gehörten zur sogenannten Daseinsvorsorge, erläutert Wirthmann.
„Die Hinterbliebenen müssen allerdings die Friedhofsordnung des Erzbistums Köln akzeptieren“, betont Meisenberg. Danach soll jede Grabstelle unter anderem „in sichtbarer und würdiger Weise ein religiöses Zeichen des christlichen Glaubens“ tragen. Angehörige könnten sich davon befreien lassen.
Für Juden ist es undenkbar, sich auf einem Friedhof mit verschiedenen Gräberfeldern bestatten zu lassen, wie der Leiter des Friedhofsdezernats des Landesverbandes der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern, Joino Pollak, sagt. Mit Blick auf die jüdischen Religionsgesetze sei so etwas „absolut unvorstellbar“.
Wirthmann sähe allgemein lieber mehr „gemischte“ Friedhöfe – eben als Spiegel der Gesellschaft. Bei Muslimen würden nach wie vor etwa 90 Prozent der Toten in ihre Heimatländer überführt. „Das wird sich aber ändern in der nächsten Generation.“ Das meint auch Yerli aus Penzberg. Und ergänzt, dass es aktuell gar nicht möglich sei, manche Toten zu überführen – etwa ins Bürgerkriegsland Syrien. (KNA/iQ)