







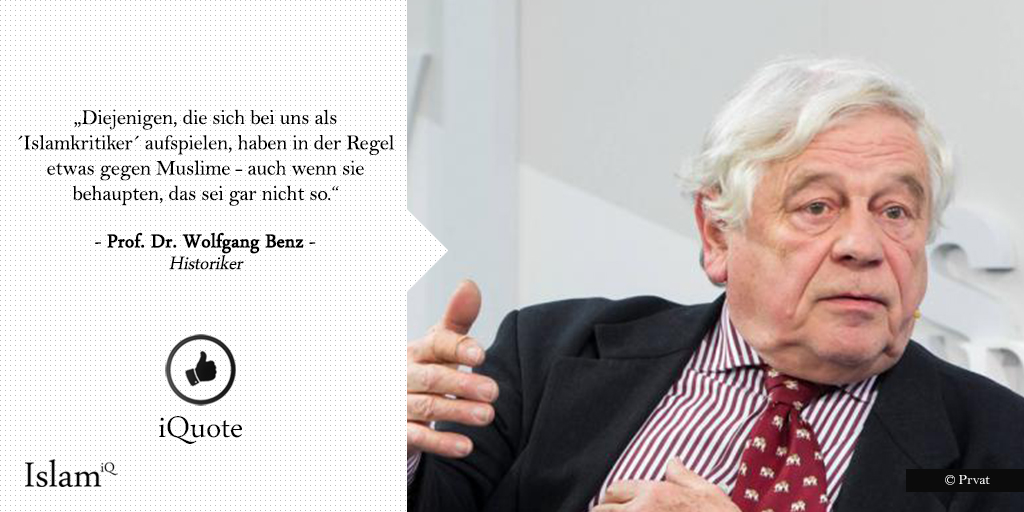

Die Terroranschläge vom 11.September jähren sich diesen Monat zum fünfzehnten mal. Wie sich die Sicht auf Muslime seit dem verändert hat, erläutern verschiedene Muslime, Journalisten und Rassismus-Experten.

Manche Muslime finden drastische Worte. „Hätten die Muslime in Deutschland und der Welt bereits damals gewusst, was durch die schrecklichen Ereignisse des 11. September 2001 in den kommenden Jahren auf sie zukommt, sie hätten sich gewünscht, in einer anderen Zeit zu leben.“ So formulierte es der Politologe Yasin Bas vor einem Jahr in der “Islamischen Zeitung“. Anlass war der Jahrestag der Terroranschläge 2001 in den USA.
Was dieser Tag für die geopolitische Lage, die Weltwirtschaft oder auch künftige Sicherheitsdebatten bedeuten würde, war nach dem ersten Schock nur zu erahnen. Auch für Muslime in Deutschland änderte sich vieles. Plötzlich sei er ständig als „Islamexperte“ gefragt gewesen, erinnert sich der Arabistikstudent Khaldun Al Saadi im Blog „kleinerdrei“. 2001 war der Autor mit jemenitischen und deutschen Wurzeln wohlgemerkt erst elf Jahre alt. Bereits als kleiner Junge habe er das Gefühl kennengelernt, „in Sippenhaft für die Taten mir völlig unbekannter Menschen genommen zu werden“, schreibt er.
Ab dem 11. September sei das Thema „Islam“ stark politisiert diskutiert worden, meint auch Bas. Der evangelische Theologe Rolf Schieder erklärt, die vier Millionen Türken, Marokkaner und Pakistaner, die in Deutschland lebten, seien mit diesem Tag im öffentlichen Diskurs zu Muslimen geworden. Darauf wäre in den 1990er Jahren noch niemand gekommen – und die Entwicklung habe zu „neuen Ausgrenzungen“ geführt, sagte Schieder im Frühjahr der „Zeit“. „Früher hieß es: ‚Ausländer raus!‘, jetzt behauptet man: ‚Der Islam gehört nicht zu Deutschland.’“
Die Islamwissenschaftlerin Lamya Kaddor verweist darauf, dass es in Europa schon immer antimuslimische Ressentiments gegeben habe. „Aber die heutigen Erscheinungsformen sind neu“, meint sie. Sie hätten sich nach den Anschlägen auf die Türme des World Trade Centers herausgebildet: „Sobald jemand muslimischen Glaubens ist, haben sämtliche andere Facetten seiner Persönlichkeit scheinbar keine Bedeutung mehr“, schreibt sie in ihrem Buch „Zum Töten bereit“.
Kübra Gümüsay bezeichnet dies als „Ethnisierung“ des Islam. „Menschen, die so aussehen, als könnten sie aus einem muslimisch geprägten Land stammen, werden oft wie Muslime behandelt“, erklärte die Bloggerin und Aktivistin mit türkischen Wurzeln kürzlich in einem Gastbeitrag auf ndr.de.
Inzwischen werde diese Wahrnehmung zunehmend instrumentalisiert, beobachtet der Extremismusforscher Wolfgang Benz. Westliche Demagogen reagierten auf das terroristische Feindbild „Westen“ mit dem Feindbild „Islam“.
Feindbilder seien schlichtweg „Produkte von Hysterie“, mahnt Benz in seinem neuesten Buch „Fremdenfeinde und Wutbürger“. „Sie konstruieren und instrumentalisieren die Zerrbilder über die Anderen.“ Seit dem 11. September habe das Klischeebild von Muslimen und dem Islam „erheblichen Einfluss auf die Emotionen und den Intellekt westlicher demokratischer Gesellschaften gewonnen“.
Die Erfolge des Front National in Frankreich, Pegida-Aufmärsche in Deutschland, erstarkender Nationalismus und Abschottung in ganz Europa – all dies lässt sich auch als Erbe von 9/11 betrachten.
Und die Spirale setzt sich fort. Laut der Politikwissenschaftlerin Petra Ramsauer spielen die Erfahrungen von Ausgrenzung eine wichtige Rolle für die Rekrutierung durch Terrormilizen wie den „Islamischen Staat“ (IS). Nach Ereignissen von 2001 hätten sich Muslime im Westen plötzlich „als Fremdkörper, unter Generalverdacht“ gefühlt, schreibt sie in „Die Dschihad Generation.“ Auch Theologe Schieder warnt: „Wer aus Angst beginnt, Muslime auszugrenzen, tappt in die Falle der Terroristen.“ (KNA/iQ)