







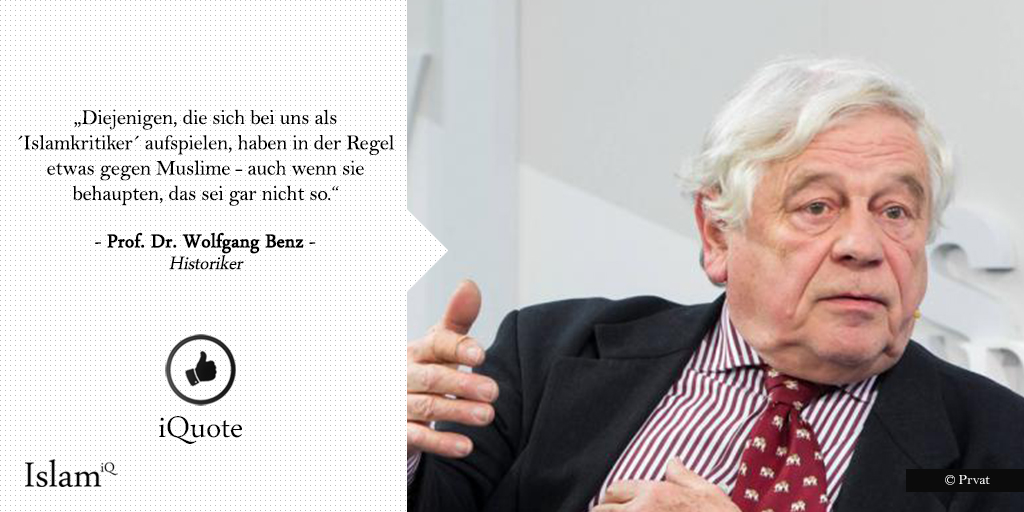

Die andalusische Astronomin Fatima von Madrid war eine begnadete Wissenschaftlerin. Ihr
Name steht aber auch für ein Problem, dem Naturwissenschaftlerinnen selbst in unserer
Zeit noch begegnen: die Diskriminierung der Frau. Von Katharina Ben Eladel

Anfang Oktober wurde die kanadische Wissenschaftlerin Donna Strickland gemeinsam mit zwei Kollegen für ihre Arbeit auf dem Gebiet der Laserphysik mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Damit ist sie nach Marie Curie (1903) und Maria Goeppert-Mayer (1963) erst die dritte Frau, die den prestigeträchtigsten aller Wissenschaftspreise in ihrem Fach entgegennehmen durfte. Leitmedien im In- und Ausland nahmen die Preisverleihung zum Anlass, um wieder einmal über die Ursachen für die Unterrepräsentanz von Frauen in der Spitzenforschung zu spekulieren.
Ein Blick auf die Abschlusszahlen in ostasiatischen und orientalischen Ländern widerlegt die beliebte These, der zufolge Frauen grundsätzlich keine Ambitionen hätten, sich in den „harten“ MINT-Fächern zu profilieren. Weitaus plausibler erscheint dagegen, dass begabte und erfolgreiche Frauen in Naturwissenschaften, insbesondere in der akademischen Forschung, in vielen Köpfen weiterhin schlicht nicht vorkommen.
Dabei ist längst klar, dass einige der revolutionärsten Entwicklungen der letzten Jahrzehnte ohne die Beiträge von Wissenschaftlerinnen gar nicht hätten zustande kommen können. Nicht selten wurden ihre Arbeiten von männlichen Kollegen jedoch kopiert, um sich mit den fremden Federn zu schmücken. Traurige Berühmtheit erlangte der Fall Rosemary Franklin. Ohne ihre Zustimmung nutzten Francis Crick und James Watson ihre Forschungsergebnisse, um die Doppelhelixstruktur der DNS nachzuweisen, wofür sie 1962 den Nobelpreis erhielten. Franklin dagegen wurde erst posthum für ihren Beitrag gewürdigt.
Noch bis in die jüngere Vergangenheit wurden Frauen an naturwissenschaftlichen Fakultäten – nachdem sie lange dafür gestritten hatten, diese überhaupt betreten zu dürfen – nicht nur strukturell, sondern ganz direkt diskriminiert. Stricklands Vorgängerin, Maria Goeppert-Mayer, sorgte sich seinerzeit, ob der Physical Review ihre Arbeit zum Schalenmodell des Atomkerns überhaupt veröffentlichen würde, wenn nicht auch der Name ihres Mentors Enrico Fermi auftauchte. Fermi selbst riet ihr nachdrücklich davon ab, ihn in der Autorenzeile zu erwähnen: „Alle werden denken, dass ich es geschrieben habe, wenn ich mit draufstehe.“
Frauen in der muslimischen Welt hatten es in dieser Hinsicht zunächst vergleichsweise leichter. Mathematik, Logik, Astronomie, Musiktheorie und Naturlehre standen bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts ganz selbstverständlich auf dem Lehrplan der religiösen Hochschulen. Zu diesen hatten Frauen als Schülerinnen und Lehrerinnen weitgehend freien Zugang, während sich in Europa Ausnahmetalente wie die Mathematikerin Emmy Noether als Mann verkleidet und in ständiger Angst vor empfindlichen Strafen bei Enttarnung in Hörsäle schmuggelten.
Erst mit den einsetzenden Modernisierungsbestrebungen in der arabisch-islamischen Welt um 1920 und der Einrichtung „westlicher“ Universitäten, wurden Frauen – ganz nach damaligem europäischem Vorbild – vom Campus verbannt. Als ebenso „modern“ galt die Auffassung, Frauen seien aufgrund ihrer geistig-emotionalen Anlagen nicht für eine wissenschaftliche Tätigkeit gemacht. Auch die islamische Welt muss ihre Wissenschaftlerinnen und deren Leistungen also erst allmählich wiederentdecken. Wissenschaftlerinnen wie die Astronomin Fatima von Madrid.
Die Tochter des Universalgelehrten Abul-Qâsim al-Qurtubî al-Madschriti wurde vermutlich um 980 n. Chr. in Córdoba geboren und starb vermutlich Mitte des 11. Jahrhunderts. Von ihrem Vater, zeitlebends ihr Mentor und größtes Vorbild, übernahm sie die Leidenschaft für die Himmelsbeobachtung ebenso wie die Liebe zur Mathematik und Geometrie. Beide arbeiteten bis zu Abul-Qâsims Tod 1007 n. Chr. eng zusammen. [1] Zu Fatimas wichtigsten Forschungsgebieten gehörten die Vermessung der Sternhöhe über dem Horizont, die Bestimmung des Sonnenstandes und der Mondphasen und die Berechnung von Finsternissen, die von grundlegender Bedeutung für die gottesdienstliche Praxis sind.
Damit folgte sie einem in Andalusien weitverbreiteten Verständnis von Sinn und Zweck des wissenschaftlichen Arbeitens. Wissenschaft wurde nicht als Selbstzweck betrachtet, sondern als Instrument. Ähnlich wie der persische Gelehrte Abû Dscha‘far al-Chawarizmî, Begründer der Algebra wurde auch Fatima von dem Wunsch inspiriert, mit ihrer Arbeit das geistige und religiöse Leben ihrer Zeitgenossen und nachfolgender Generationen zu bereichern und vor allem zu erleichtern.
Sie überarbeitete Grundlagenwerke der damaligen Astronomie, darunter den „Almagest“ des Claudius Ptolemäus oder die Al Chawarizmîs Tafeln, um die darin enthaltenen Angaben für ihre geographische Heimatregion nutzbar zu machen. Als Hauptproblem erwies sich dabei, das Al-Chawarizmî sich am altpersischen Sonnenjahr orientierte, und sämtliche Berechnungen an den islamischen Mondkalender angeglichen werden mussten. Ein Exemplar ihrer „Abhandlung über das Astrolabium“ wird bis heute in der Bibliothek des
Klosters El Escorial in Madrid aufbewahrt. Fatimas Hauptwerk, die „Korrekturen der Fatima“, gelten dagegen als verschollen. Dies hat einige zeitgenössische Historiker dazu veranlasst, über die tatsächliche Existenz Fatimas von Madrid zu spekulieren. In einigen Werken werden die Korrekturen der chawarizmî‘schen Tafeln ihrem Vater zugeschrieben, dessen Wirken am Hofe des Kalifen von Córdoba Abd ar-Rahmân III. historisch gut belegt ist.
Dr. Juan Núñez Valdés, Mathematiker an der Universität von Sevilla, hält es dagegen für sehr wahrscheinlich, dass Fatima von Madrid tatsächlich gelebt hat. Die Geschichtswissenschaft komme eigentlich ohne großen Erfindungsreichtum aus, wenn es darum gehe, die Existenz von Naturwissenschaftlerinnen früherer Jahrhunderte zu belegen, meint Núñez Valdés.
Dennoch „sind üblicherweise nur wenige Literaturverweise erhalten, die in der Regel auch nicht entsprechend verbürgt sind.“[2] Möglicherweise hat Fatima einfach dasselbe wissenschaftliche Schicksal ereilt, wie so vielen ihrer späteren Kolleginnen: Man nahm an, ihr Vater habe die Arbeiten geschrieben, weil er „mit draufstand“.
[1] Bernardi, Gabriella. 2016. Fatima of Madrid. In: The Unforgotten Sisters. Female Astronomers and Scientists before Caroline Herschel, S. 45-48. Chichester: Springer PRAXIS.
[2] Núñez Valdés, Juan (2016): Did Fatima of Madrid really exist? Review of Social Sciences 1(2): 19-26