







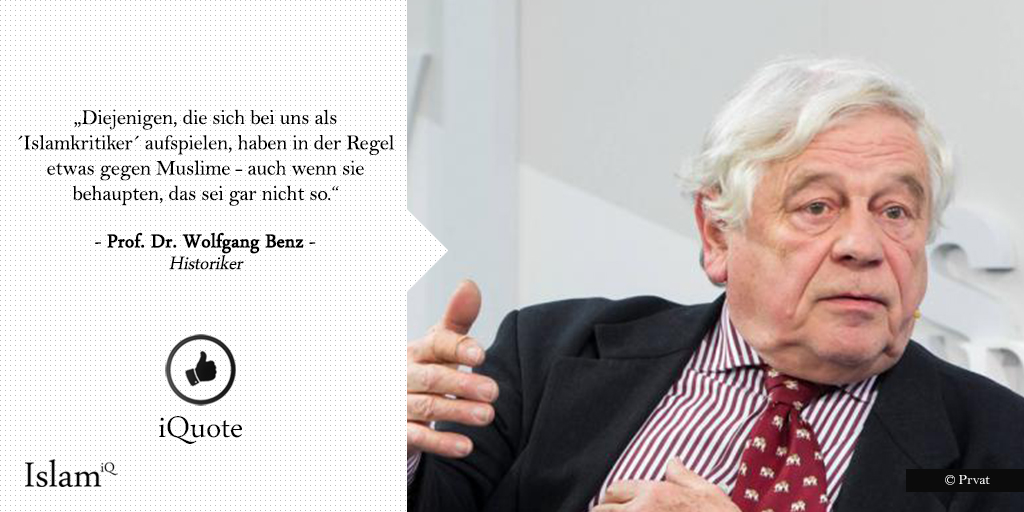

Der Tag der offenen Moschee ist noch in vollem Gange. Michael Merten (KNA) hat bereits die Şehitlik Moschee in Berlin besucht und berichtet von seinen Eindrücken. Er betont: Muslime wollen als Teil der Gesellschaft wahrgenommen werden.
Etwas irritiert fragt die Italienerin nach. Sie möchte einen dieser leckeren Kuchen, doch das geht nicht so einfach. Die kleine Touristengruppe hat sich in den Vorhof der Berliner Şehitlik-Moschee am Columbiadamm verlaufen, begutachtet interessiert die zahlreichen Stände mit Broschüren, Speisen und Tee. Doch den Käsekuchen, das Baklava und die Falafel gibt es nicht gegen Bares. „Sie müssen erst eine Wertmarke kaufen“, erklärt eine junge Helferin. Alles perfekt organisiert an diesem „Tag der Offenen Moschee“. Typisch deutsch, könnte sich die Italienerin denken.
Typisch deutsch sind auch viele Vorbehalte in der hiesigen Gesellschaft. Obwohl der Islam vermeintlich längst zu Deutschland gehört, war 2014 kein gutes Jahr für die Integration. Der Gaza-Krieg, ein neu aufflammender Antisemitismus in Deutschland, der Terror der IS-Milizen im Irak und in Syrien, Kriegs-Tourismus und eine dubiose „Scharia-Polizei“ verunsichern viele Bundesbürger. „Man verliert ein bisschen die Motivation“, sagt Ender Çetin, Vorsitzender der Sehitlik-Moschee. Er betreibt viel Aufklärungsarbeit, aber: „Negative Nachrichten auf der ganzen Welt zerstören unsere Arbeit.“
Resignieren will der 38-Jährige aber nicht. Am Morgen des 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, hat er mit Dutzenden Ehrenamtlichen und großem Aufwand alles für den „Tag der Offenen Moschee“ vorbereitet. Seit 1997 gibt es die Aktion. Bis zu 100.000 Besucher kommen jährlich in über 1.000 Moscheen und Bet-Räume.
Vor der Tür der prächtig ausgeschmückten Moschee sammeln sich schon morgens zahlreiche Schuhpaare: von interessierten Besuchern, aber auch von vielen Kamerateams. Çetin zeigt auf den mit Teppichen ausgelegten Boden und räumt mit einem Missverständnis auf: „Viele Leute denken, dass wir die Schuhe aus sakralen Gründen ausziehen. Doch das machen wir, damit wir beim Beten nicht mit der Stirn im Dreck landen“, erklärt der Theologe. Beredt und volksnah lädt er zum Moscheebesuch auch außerhalb von Führungen ein: „Man kann einfach reingehen und relaxen.“
Derweil verteilt die 20-jährige Neuköllnerin Mihriban Keysan Broschüren. Die Jura-Studentin engagiert sich in der Jugendarbeit der Moscheegemeinde. Sie lächelt freundlich, und, ja – ihre Haare bedeckt ein Kopftuch. Das sei nach wie vor ein bestimmendes Thema bei den vielen Führungen mit Schulklassen oder gesellschaftlichen Gruppen. Nicht freilich bei den Muslimen, von denen die Wenigsten an diesem Tag einem Klischee entsprechen.
In ihrer Jugendgruppe, so erklärt Keysan, gebe es wie bei Nichtmuslimen viele, die sagten: „Ich glaub zwar dran, aber ich bin nicht so krass religiös.“ Ziemlich normale Teenager eben. Sie selbst habe, bis auf gelegentliche Sprüche, keine negativen Erfahrungen wegen ihres Kopftuchs gemacht. Keysan hofft, dass sich in Sachen Integration schneller etwas tut: „Die Gesellschaft muss sich auf uns zubewegen – aber auch umgekehrt“, ist sie überzeugt.
Der 34-jährige Brandenburger Remo ist skeptisch. Das Verhältnis von Muslimen und Mehrheitsgesellschaft sei „derzeit ziemlich vergiftet“. Als Atheist aus der DDR habe er früher kaum Kontakt zu Muslimen gehabt. Nach der Wende sei der erste Döner-Verkäufer noch eine Sensation gewesen. Heute habe er viele muslimische Freunde. Er versteht manche Feindbilder nicht: „Was haben Muslima mit Kopftuch mit Terroristen zu tun?“
Ein solches Verständnis wünscht sich Ender Çetin von der Gesellschaft. Es müsse ja nicht unbedingt ein muslimischer Oberbürgermeister sein, erklärt er diplomatisch. Am selben Tag schaut auch der Berliner SPD-Kandidat für das Amt mit palästinensischen Wurzeln, Raed Saleh, in der Moschee vorbei.
Mit Blick auf das diesjährige Motto „Soziale Verantwortung“ des Aktionstags verweist er auf das Engagement für Pflegekinder, Arme und Flüchtlinge. Seine Helfer machen Kurse über den Islam und die anderen Religionen; sie haben zusammen mit Juden einen Flashmob gegen Ausgrenzung gemacht. Für Çetin wäre es ein wichtiger Erfolg, wenn Muslime „nicht immer nur beim Thema Sicherheit gefragt werden“ – sondern als Teil der Gesellschaft wahrgenommen werden. (KNA)